* langtexthinweis
Johannes Beringer: Zu Grandrieux (Sombre, 1999 / La vie nouvelle, 2002)
Johannes Beringer: Zu Grandrieux (Sombre, 1999 / La vie nouvelle, 2002)
* Cinema Redux
„This explores the idea of distilling a whole film down to one single image. Using eight of my favourite films from eight of my most admired directors including Sidney Lumet, Francis Ford Coppola and John Boorman, each film is processed through a Java program written with the processing environment. This small piece of software samples a movie every second and generates an 8 x 6 pixel image of the frame at that moment in time. It does this for the entire film, with each row representing one minute of film time.
The end result is a kind of unique fingerprint for that film. A sort of movie DNA showing the colour hues as well as the rhythm of the editing process. (…)“
[via sofa]
„Ein Geheimnis der Verkörperung“. Über „Gertrud“ von Carl Theodor Dreyer (1964). Von Manfred Bauschulte
Das Mieseste am Film ist sein blöder Anglotitel: „Identity Kills“, Sören Voigt, D 2003, 81 Min.
Brigitte Hobmeier, die sog. Hauptdarstellerin, steht an einem Glaskasten, in dem Figuren aus geschliffenem Kristallglas feilgeboten sind. Eine negroide Verkäuferin kommt dazu, sperrt die Vitrine auf und drückt ihr zur Begutachtung ein gläsernes Schildkrötelchen in die Hand. Über die Maßen lang steht B.H. mit dem Kleinod in Händen, ohne Zicken und Mucken. Die Verkäuferin im Vordergund frägt, als das Maß überschritten ist, ob ihr nicht gut sei – Zurechnungsfähigkeit in Frage gestellt.
B.H. hat, in meinen Augen, ein Püppchen-Gesicht, hütet sich aber vorm Mißbrauch, keine Faxen, kein Geschrei, das Expressive nach Innen gestülpt – dies scheint die Nöte der Dargestellten auszumachen.
Sie jobbt in einer Besteckfabrik. Man sieht, wie Blechplatten geschnitten, die Abschnitte auf ein Förderband sortiert werden, sie Stanzstücke von Hand unter die hydraulische Presse setzt, die das Blech ins Negativ einer Gabel drückt.
An einer Autobahnraststätte, beim Transport der Ware zum Kunden, hintergeht sie die Kollegin, die noch am Essen ist – ich schmecke geradezu das Besteck – und verscherbelt ein paar Gedeckkoffer an Automobilisten.
Im weidenen Wäschekorb lagert sie Geld und Reiseprospekt für einen Trip nach DomRep, von wo sie während der Kopfmassage beim Friseur erzählen hört. Die Karibikinsel, auf der es einen Hoteljob gibt, rutscht ihr in die Persönlichkeitsspalte und wird zum Spleen, den sie verfolgen möchte trotz Heirats mit einem Sportwagenfreund. Es hakt und hapert zwischen beiden; Beziehungsprobleme löst er, indem er den Einkaufswagen bedient. Auf den spröden Weidenkorb legt sie sich einmal, als wäre es ein plüschiger Kinderteddy.
Diese Frau, B.H., kommt mir in dem Film vor, wie eine Mutantin der Mouchette.
 |
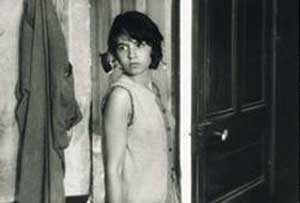 |
Zur Wesenswendung – kein Widerspruch – kommt es, als sie einen Plan faßt und eine Hintertreibung begeht, ein Spiel beginnt mit einer Hotelfachfrau, jener Parallelkundin beim Friseur, der sie – oh je, ganz ohne 19. Jahrhundert kommt das Drehbuch nicht aus – zufällig wiederbegegnet. Sie übernimmt den Part der eine Stelle feil bietenden Hotelmanagerin, nachdem sie sich eine Ausrüstung zusammenklaute – vom Kostümchen über den Aktenkoffer bis hin zur Sonnenbrille, die sie von einer zum Nachsetzen zu schwer bepackten Passantin pflückt. Sie inszeniert sich selbst, und man sieht ihr dabei zu, wie einer Verbündeten.
Nach dem nur hörbaren Mord an der Genasführten vollzieht sie den Rollentausch und zieht dieser die Kleider vom Leib. Sie drückt sich den Rock ins Gesicht, um den Duft der anderen in sich aufzunehmen.
Einer der merkwürdigsten Filme der letzten Zeit: „The Cooler“, Regie Wayne Kramer. William H. Macy in seiner meines Wissens nach ersten wirklichen Hauptrolle. Er spielt einen Pech abstrahlenden Loser namens Bernie Lootz, aus dessen Unglück Alec Baldwin als Casinobesitzer in Las Vegas Kapital schlägt, indem er ihn immer an die Tische schickt, wo grad wer Glück hat. Macys Pech ist es, dann plötzlich selbst mal Glück zu haben: Er verliebt sich. Darüber ist dann allerdings der Casinobesitzer, der ihm aus ganz anderen Gründen vor Jahren mal mit einem Baseballschläger die Kniescheibe zerschmettert hatte, unglücklich. Er tritt Macys zu diesem Zeitpunkt noch als schwanger gelten müssenden Schwiegertochter, die mit seinem verschollenen Sohn plötzlich aus dem nichts auftaucht, in den Bauch (sie ist, wie sich nach dem Tritt herausstellt, doch nicht schwanger, sondern will mit dem Kissen unterm Pulli Mitleid hervorrufen und Kohle aus Macy herauskitzeln) und zerschlägt jetzt dem Sohn, der zuviel gewonnen hat, die Kniescheibe. Das findet aber jeder normal da, that’s Vegas, jedenfalls ist es kein ausreichender Kündigungsgrund für Macy. Die Casinobesitzer machen weiter, die Kellnerinnen machen weiter, die Geschichtenerzähler machen weiter.
 |
Die Einzelteile des Films sind so montiert, dass daraus Buster Keatons Haus in „One Week“ entsteht. Entweder die Reihenfolge der Einzelteile stimmt nicht oder die Proportionen, man kriegt es bis zum Schluss nicht ganz klar im Kopf und sitzt ungläubig im Kino, teils nur durch eine hauchdünne Membran von der gutgelaunten Hysterie, die minütlich wächst, getrennt.
Am schönsten ist der Film, wenn er sich ganz hineinfallen lässt in völlig unabgefederte visuelle Spirenzien, die absolut NICHTS erzählen wollen:
* Ein Salzstreuer, den Macy im Diner umstößt, ist nicht nur ins Maßlose vergrößert; die völlig banale Art seines Umfallens ist noch dazu in Superzeitlupe zerdehnt. Beides, um zu sagen: „Der Macy, der hat Pech. Mann, hat der Macy ein Pech. Dass der Macy aber so ein Pech haben muss.“ (Das wusste man natürlich schon längst vorher, schon bevor der Film angefangen hatte).
* Macys zweiter Gang aus dem Fahrstuhl. Er ist jetzt, anders als zu Beginn, verliebt und weiß, dass auch er geliebt wird. Alles hat sich geändert, Luck is on his side. Als er einen Fuß vor den anderen setzt, wird dieser eine Schritt, vielleicht eine halbe Sekunde lang, plötzlich ganz aufwändig von unten durch eine Glasplatte gefilmt. Es ist eine formale Differenz, ein Sprung, aus dem nichts folgt und der auch seinerseits aus nichts folgt. Man versucht es sich einen Moment lang zu erklären und die Schuhsohle mit Macys existentieller Veränderung zusammenzubringen, dann kapituliert man vor der Unverhältnismäßigkeit der Mittel.
* Plötzlich, an einem der Spieltische, die Röntgenaufnahme einer würfelnden Hand, man fragt sich noch, was das jetzt wieder soll, da fährt die Kamera zurück. Sie hat offenbar in Baldwins Auge hineingeschaut und damit seinen Röntgenblick nachempfunden, der nur hier, an dieser einen Stelle zum Einsatz kommt: So ein Röntgenblick, der will doch für was stehen, wundert sich die kurze Sequenz noch, im nächsten Augenblick ist sie schon vergessen, von einer weiteren Unbeholfenheit verschluckt worden.
In ein solches Metapher-sein-wollen versteigt sich der Film immer wieder, auch in den Dialogen: Baldwins Casino alter Schule inmitten der neuen, modischen Läden des Strip: ein „Museum“. Der abgehalfterte, alt gewordene Entertainer, der an der Nadel hängt und immer noch weiter singt: ein „Löwe“, der verwundet auf seinen Tod wartet und sich von den anderen Tieren der Herde zum Sterben entfernt.
Man muss sich Wayne Kramer als jemanden vorstellen, der wie ein Kind irgendwann entnervt die Bauklötze hinschmeißt, weil nichts so hinhaut, wie er es sich vorgestellt hat. Er hat die Schauspieler, er hat das Geld, er hat eine schöne Märchengeschichte. Er versteht es selbst nicht so ganz. Vielleicht hat er einfach nur Pech. Ohne rechten Enthusiasmus, eher aus familiärer Verbundenheit, versuchen die Eltern das ganze dann doch noch hinzubiegen am Schneidetisch.
Oder, und das fände ich noch viel toller: er hat das GENAU SO gewollt. Dann aber wäre er ein Genie.
Heinz Emigholz hat über „The Fountainhead“ von King Vidor geschrieben: „An diesem Film stimmt nichts“, und zwei Sätze weiter: „Gerade deshalb lieben wir ihn.“ Beides läßt sich auch über „The Cooler“ sagen.
Was Gewaltbilder berühren – Michael Girke zu Klaus Theweleits neuem Buch „Deutschlandbilder“
* cyclad-z: weblog & screeninglog
Suggested citation:
Rosenbaum, Jonathan. Moving Places: A Life at the Movies. Berkeley: University of California Press, c1995. http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft3s2005n8/
Umsonst und da draußen.
[via url]
Fast bin ich mir sicher, diesen Film schon einmal geträumt zu haben.
Rüdiger Tomczak bei Shomingeki über Hiroshi Shimizus Arigato-San.
Und nachdem ich gestern den vermeintlich weniger bedeutenden Shimizu-Film „Children of the Beehive“ gesehen habe, kann ich nur raten: alles stehen und liegen lassen und im März ein Zelt im Arsenal aufschlagen.
* langtexthinweis – Ekkehard Knörer zu Philippe Grandrieuxs „La Vie Nouvelle“ (Frankreich 2002)