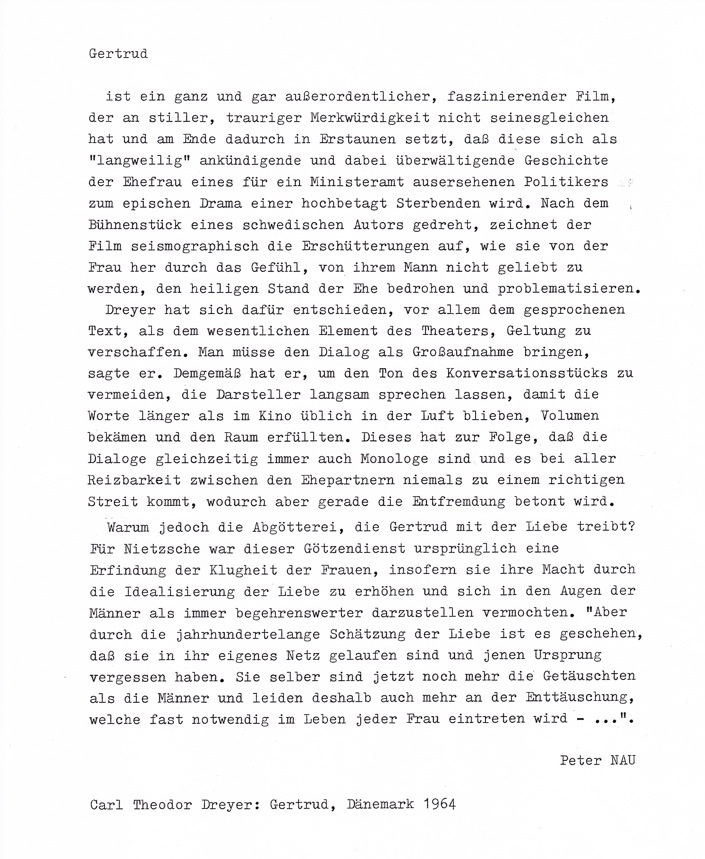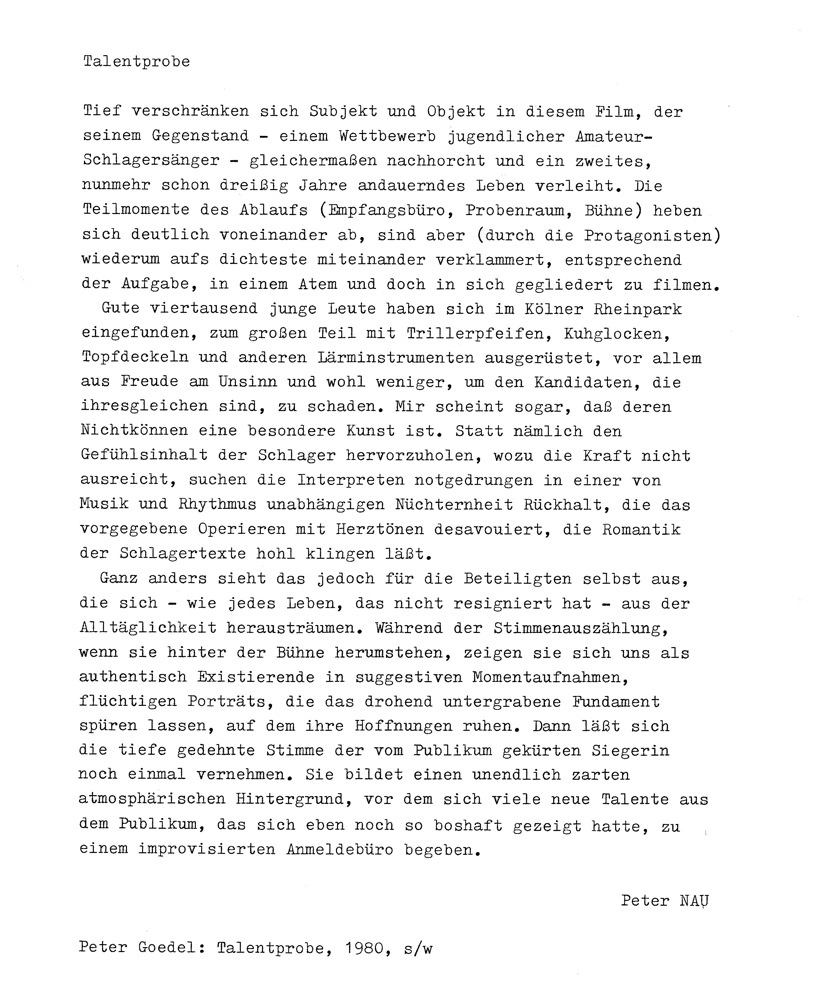März 2010
Dienstag, 30.03.2010
Montag, 29.03.2010
Niemand ruft
Nikt nie wola (Niemand ruft, Polen 1960) von Kazimierz Kutz scheint mir innerhalb der ‚polnischen Schule’ der 50er und 60er Jahre (Has, Kawalerowicz, Konwicki, Morgenstern, Munk, Rózewicz, Wajda u.a.) etwas Besonderes zu sein. Wenn diese Schule die Vorgaben des sozialistischen Realismus durch Anlehnung an den italienischen Neorealismus und an den amerikanischen ‚Film noir’ überwand, so geht Kutz in seinem Film noch einen Schritt darüberhinaus. Das sonst abendfüllende Sujet – ein ganz junger Mensch, Angehöriger der polnischen Heimatarmee, hat sich geweigert, auf ‚Rote’ zu schiessen und ist nun auf der Flucht – wird in den Hintergrund (und ins Off) verbannt und spielt erst ganz am Ende wieder eine Rolle. Der Anklang an Popoliu i diamentu (Asche und Diamant, Polen 1958) von Wajda ist allerdings nicht zufällig: nur wollte Kutz in seinem Film das romantisch Aufgeladene der Figur (dort von Zbigniew Cybulsky gespielt) und die dramatische Zuspitzung vermeiden.
Ein Eisenbahnzug, vollgepackt mit Flüchtlingen und Vertriebenen, fährt in einen Ort (im Film Zielno genannt) ein: das ist real das niederschlesische Habelschwerdt, danach Bystrzyca Kłodzka, aus dem die Deutschen vertrieben worden sind. Der Strom der Menschen ergiesst sich in die leere Stadt, Trinkwasser wird ausgeteilt, Unterkünfte und Wohnungen werden in Beschlag genommen. Zwei junge Menschen haben sich herausgeschält aus der Menge: Lucyna (Zofia Marcinkowska) und Bozek (Henryk Boukolowsky) – er hat eine baufälliges Haus, fast eine Hütte, am Fluss bezogen, sie lebt mit ihrer kleinen Schwester in einem mit ‚Internat’ bezeichneten Heim. Zwischen den beiden entspinnt sich eine Liebesgeschichte – doch der Film behandelt die Beziehung eher wie eine ‚Versuchsanordnung’, nimmt das Transitorische der Situation ernst und bleibt im wahrsten Sinn episodisch. Sehr viele Dialoge zwischen Lucyna und Bozek finden vor alten, fleckigen, abgerissenen Mauern statt – was die Körper, die Gesten, die Worte wie ‚ausgestellt’ erscheinen lässt. Das sind ‚optisch-akustische Situationen’. (Hinter dem Leichten, Flüchtigen, Episodischen macht sich jedoch immer wieder ein ‚Grundgefühl’ der Angst bemerkbar. Oder wie Reiner Schürmann in „Origines“ / „Ursprünge“ schreibt: „Mein Erinnerungsvermögen hat sich auf Angstzustände spezialisiert.“)
Zurecht weist Rafal Marszalek im polnisch-englischen DVD-Booklet auf den Zug zum ‚Antonionischen’ des Films hin, vergleicht die Kameraarbeit von Jerzy Wójcik mit der von Carlo di Palma [vielleicht könnte man auch an Gianni de Venanzo denken]. Der Film sei 1960, schreibt er, völlig verkannt worden und durch einen administrativen Akt etwa 25 Jahre lang nicht in den Verleih gekommen. Die polnische Kritik habe damals vor den „Gefahren des Modernismus“ gewarnt und sich gefragt, wovon der Film überhaupt handle. Ausser vagen, gelegentlichen Versuchen, sei diese artistische Spur erst mit dem Film-Debut von Skolimowski wiederaufgenommen worden. [Mir scheint jedoch, dass zum Beispiel auch schon der sehr schöne Polanski-Film Nóż w wodzie (Das Messer im Wasser, Polen 1962), dessen Drehbuch er zusammen mit Skolimowski schrieb, in diese Reihe gehört.]
Man könnte bei Niemand ruft zum Beispiel noch hinweisen auf das angenehme Wesen der Hauptdarstellerin – Zofia Marcinkowska –, ihr hübsches Aussehen (das sich im Verlauf des Films als sehr veränderlich erweist): sie hat es in ihrer Zeit immerhin auf die Titelseiten von einigen polnischen Zeitschriften gebracht. Nur blieb ihre Zeit sehr kurz bemessen: 1963, 23jährig, hat sie Selbstmord begangen.
Eine Nebenlinie des Films möchte ich noch erwähnen. Es gibt da einen gestandenen Menschen – ein Arbeitertyp, der zum ‚Wanderer’ geworden ist –, der beim Gang vom Zug in die Stadt von Bozek ein Glas Wasser verlangt (der hatte eben eine Wasserflasche erstanden). In der Stadt, bevor er verschwindet, ruft er Bozek über die Menge hinweg zu, dass er vielleicht morgen schon Bürgermeister sei. Danach sieht man ihn allerdings nur immer am Brückengeländer stehen und auf den Fluss hinunterstarren. Die Qualität des Wassers behagt ihm nicht, die ist in dem Ort, aus dem er gekommen ist, besser. Bozek muss des öfteren an ihm vorbeigehen, zögert hie und da ein bisschen, aber gesellt sich dann regelmässig zu ihm, wechselt ein paar Worte. Mehr nicht. Dieses Nicht-einfach-Vorbeigehen, das er da zu einer Regel macht, bürgt doch auch schon für etwas – oder nicht?
Freitag, 26.03.2010
Zukunft
Was ist das Kino? Zuallererst ein rätselhafter Ort. Ich nenne nur als Beispiel den Palast, der am einzigen Boulevard der Stadt, dem Hohenzollernring, 1931 erbaut, verborgen hinter einer Bürofassade damals 3000 Plätze hatte. Die feine Architektur, mit selbstverständlichen Schwüngen und klugen Kurven, wurde irgendwann dann zerschachtelt in 13 mitunter wild verwinkelte Kinoräume. Schmale Gänge führen zu den Projektorkammern oder überraschend auch mal in einen großen Saal (Kino 11), einst ein gewaltiger Balkon, mit zwei kleinen Logen. Separees! Aus Sparsamkeit erhaltene Details und Proportionen erzählen bis heute davon, wie es war – sein müsste – nicht bleiben konnte. Aber wer wie ich, viel Zeit verbrachte in diesem gigantischen Versteck, während drum herum die großen Säle der Stadt nacheinander schließen mussten, der lernte es zu respektieren, mehr noch, fand Gefallen am Martialischen dieser bizarren Umrüstung. Es gibt da eine kleine Brücke, die ein altes Treppen-Schneckenhaus frech durchkreuzt. Das sieht aus, als wären auf mexikanische Art gekreuzte Patronengurte im Traum zur zivilen Architektur geworden.
Vorgestern – und gestern dann gleich noch einmal – sah ich Eyyvah Eyvah, der in Köln im Filmpalast (OmU) und in vielen anderen deutschen Städten läuft, auch wenn kein deutsches Feuilleton darüber schreibt. Es wäre auch gar nicht so einfach, das zu tun. Typisch für diesen Film, dass mittendrin ein Musiker den Streit mit einem Kollegen nicht scheut, um die Tonart eines Lieds an die Stimmlage der Sängerin anzupassen. Sorgfalt, Geduld und Zartheit sind dem Film so selbstverständlich, dass es kaum zu fassen ist. Wären Schönheit und Humor allein – Rhythmusgefühl und kinematographische Weisheit noch dazu – Vergnügen an Sprache und Licht obendrein – die Kriterien des Europäischen Filmpreises, dann wäre diese türkische Komödie wohl der sichere Gewinner. Es gibt aber, nehme ich an, noch ganz andere Ansprüche. Die Leute jedenfalls, für die der Film gemacht ist, wissen in welchen Kinos er läuft, in Aschaffenburg, Augsburg, Bielefeld, Berlin, Bochum, Bremen, Bretten, Crailsheim, Darmstadt, Dillingen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Erbach, Essen, Frankfurt, Freiburg, Gelsenkirchen, Günzburg, Hamburg, Hannover, Hechingen, Hürth, Karlstadt, Kelheim, Köln, Krefeld, Landshut, Lichtenfels, Marktredwitz, Mannheim, Meschede, Memmingen, Mosbach, München, Neckarsulm, Nürnberg, Osnabrück, Salzgitter, Schrobenhausen, Sindelfingen, Stuttgart, Walldorf und Wuppertal. Denn was ist das Kino eigentlich? Gar kein Ort. Flucht. Sache von Einwanderern. Zukunft.
Demet Akbağ und Ata Demirer
EYYVAH EYVAH von Hakan Algül
Erwähnen muss ich noch das winzige Kino 13 oben rechts unterm Dach des Filmpalasts. Für viele war es sicher eine bittere Enttäuschung, aber für jeden war es ein Erlebnis. Ein in der ganzen Welt einzigartiger Raum, ein Polyeder von grausamer Kompliziertheit. Unzählbar seine Ecken, seine stumpfen und spitzen Winkel. Unbegreiflich die Geländer, Ebenen, Schrägen, Stufen überall, selbst M.C. Escher wäre gestolpert. Irgendwo war oder ist auch noch ein Kühlschrank. Früher hieß es „Ufa 13“, für mich heißt das Ding auf ewig so. Dieser liebgewonnene teppichbodenbezogene Hohlkristall. In den letzten Jahren sah ich dort einige Filme mit Will Ferrell. Niemand, der das Gefühl nicht kennt, kann sich vorstellen, wie es ist, in einem halb kubistischen, halb expressionistischen Rhombikosidodekaeder zu sitzen und Old School auf der Leinwand anzuschauen. Ich habe mir deshalb jetzt vorgenommen, den Raum, als Mitglied eines internationalen Forscherteams, mit Echolot zu vermessen und ihn auf der nächsten Dokumenta nachzubauen, aus Krokant.
Dienstag, 23.03.2010
Tageskino
„In der Münzgasse hinter dem Alexanderplatz befinden sich mehrere Tageskinos, die alle schon um 11 Uhr vormittags eröffnen. (…) Wie in jenen verschollenen Zeiten, als noch die Filme stumm waren und schöner, muss man an der niederen Leinwand vorbei in die Hintergründe des Zuschauerraums, der ein unermesslich langer Schlauch ist. Er strömt einen Geruch aus, an dessen Herstellung offenbar Generationen gearbeitet haben, und wimmelt von Menschen.“ Wir erleben auch mit, wie Hans Albers („der Favorit der Münzstraße“) zu Heinz Rühmann in die Badewanne springt und das Publikum begeistert ist, als er den Schmächtigen mehrmals untertaucht. – Von diesem Kinobesuch erzählt Siegfried Kracauer in dem schönen Band „Straßen in Berlin und anderswo“, der neu herausgegeben wurde, 1964 zuerst erschienen, blieb er fast unbeachtet. Die Sammlung von Feuilletons (entstanden zwischen 1926 und 1933) lässt uns Kracauer als wachen und auch wahr-träumenden Beobachter des Vorkriegsalltags kennen lernen. Und nicht nur für Filmfreunde ist der Text „Ansichtspostkarte“ aufregend und unheimlich zu lesen, weil sowohl Kommendes hinein- oder herausgelesen werden kann. Die Ausgabe ist mit einem (interessante Verbindungen herstellenden) Nachwort von Reimar Klein versehen. Siegfried Kracauer, Straßen in Berlin und anderswo, Bibliothek Suhrkamp, Frankfurt, 2009, 268 Seiten, 15,80 €.
Freitag, 19.03.2010
Quand la loi n’est pas juste, la justice passe avant la loi.
Unter den Titeln FILM ANNONCE 2 und FILM ANNONCE 6 ist seit ein paar Tagen mehr als nur ein Trailer zu Godards SOCIALISME (2010) auf youtube und vimeo zu sehen. Wenn ich es richtig verstehe, ist vielmehr der gesamte Film dort veröffentlicht, allerdings auf die Länge von 4 Minuten und 6 Sekunden (in vimeo auf 1 Minute 6 Sekunden) beschleunigt und von hinten nach vorne abgespielt. In Final Cut dürften es 2 Handgriffe sein, den Film auf seine ursprüngliche Dauer umzurechnen und die Richtung zu ändern.
Interessantes Konzept von viralem Marketing und Vergesellschaftung – gesetzt den Fall, das kommt von Godard selbst, wofür die Godardesken Texteinblendungen sprechen. Sozialismus anno 2010, for those who don’t have the time. Der Screenshot stammt aus dem Abspann des Trailers & somit aus dem Vorspann des Films: Wenn das Gesetz nicht gerecht ist, geht Gerechtigkeit vor Gesetz.
Sonntag, 14.03.2010
PODWÓRKA
Ich wusste, dass Sharon Lockhart ihren Film DOUBLE TIDE, bei der Berlinale im Forum gezeigt, mit Robert Gardners Bolex-Kamera gedreht hat. Wie das genau vonstatten ging, ob es also derart große Magazine für eine Bolex gibt, dass darin Material für knapp 50 Minuten Platz findet, wusste ich nicht. Das war eine kleine Irritation, denn für mich sah es so aus, als bestehe der Film aus zwei sehr langen Einstellungen. James Benning, dessen Film RUHR und insbesondere die letzte Einstellung des Films ausgreifende Diskussionen und Klarstellungen in den Kommentarspalten verschiedener Web-Seiten provoziert hat, erläutert nun in diesem Interview, dass Lockhart für den Film insgesamt 10 Einstellungen von je 10 Minuten Länge gedreht hat. Die Muschelsammlerin Jen Casad, die bei der Verrichtung ihrer Arbeit gezeigt wird, hat, so Benning, immer dann, wenn eine Rolle zuende ging, in der Bewegung innehalten müssen, um nach dem Rollenwechsel die Bewegung an der gleichen Stelle fortsetzen zu können. Der Film wurde dann auf HD überspielt, um die Einstellungen am Computer, nehme ich an, nahtlos miteinander zu verschweißen.
Auch Lockharts Film PODWÓRKA, ebenfalls von 2009, ist auf 16mm gedreht und wird digital projiziert. Auf der Berlinale war er etwas versteckt in einem Kurzfilmprogramm von »Forum Expanded« zu sehen. Seit letzter Woche und noch bis zum 10. April läuft er in der Galerie Neugerriemschneider in der Linienstraße 155, Berlin. PODWÓRKA ist das polnische Wort für »Hinterhof«. In sechs solchen Hinterhöfen der Stadt Lodz – es wird mir nicht gelingen, die korrekten Akzente und Buchstaben dieses Städtenamens auf der Tastatur zu finden – spielt der Film und spielen die Kinder und Jugendlichen, die in Lodz leben. PODWÓRKA ist 31 Minuten lang und sehr schön.
Samstag, 13.03.2010
Pluto
Seine Entdeckung gab man am 13. März 1930 bekannt. Tags darauf schlug die 11jährige Venetia Burney vor, den von der Sonne am weitesten entfernten Planeten nach dem römischen Gott der Unterwelt zu benennen. Eine neue Disneyfigur wurde Monate später auf den selben Namen getauft.
„Pluto trat meistens als der Haushund von Micky Maus auf, obwohl er auch,“ so formuliert es Wikipedia, „sowohl der Hund von Donald Duck als auch der von Goofy war, der ebenfalls ein Hund ist.“ Es stiftet Verwirrung, in dieser Welt ein Tier zu sein, das nicht redet und sich nicht bekleidet.
1941 gab man dem 94. Element – nach Uran und Neptunium – den naheliegenden Namen Plutonium. Lange galt der Merksatz: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten.
Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun… Im Februar 2000 eröffnete das American Museum of Natural History neue Räumlichkeiten ohne ein Modell des in die wissenschaftliche Diskussion geratenen „Zwergplaneten“. Will Galmot schrieb einen Protestbrief.
Donnerstag, 11.03.2010
Erziehung der Gefühle
Schon vor ein paar Tagen hatte mir ein Freund aus Paris den Hinweis auf einen Artikel in Les Inrockuptibles (Ausgabe 742, 17. Februar 2010) geschickt. Jean-Marc Lalanne schreibt dort über den Abend zu Ehren Eric Rohmers, der am 8. Februar in der Cinémathèque française stattfand. Der Text endet so:
»Aber den Schock des Abends löste die Entdeckung eines kleinen Films von Jean-Luc Godard aus, den er für den Anlass gemacht hatte. Auf einer schwarzen Leinwand erscheinen nacheinander die Titel der bekanntesten Artikel Rohmers in den Cahiers. Aus dem Off gesprochen evoziert Godard unsichere Bilder aus lange vergangenen, unschuldigen Tagen: zwei junge Freunde, in einer nächtlichen Unterhaltung; die selben beiden in der Küche der Mutter des einen, die ihnen zu essen macht, während sie weiter über Filme diskutieren… Selten hat man Godard über so persönliche Dinge sprechen hören, ganz einfach und ungeschützt. Der Film endet mit einer flüchtigen Einstellung des Filmemachers, etwas scheu vor seiner Webcam. Schon ist er verschwunden. Man würde ihn gern festhalten. Man würde sie beide gern festhalten.«
Nun kommt von Markus Nechleba eine Mail, dass dieser Film von Godard inzwischen auf den Seiten der Cinémathèque zugänglich ist, zusammen mit sehr viel weiterem Material von diesem Abend. Von den Rohmer-Titeln sind mir viele fremd; vertraut dagegen sind mir die letzten Sätze, die Godard in die Kamera spricht:
– C’est là ce que nous avons eu de meilleur ! dit Frédéric.
– Oui, peut-être bien? C’est là ce que nous avons eu de meilleur ! dit Deslauriers.
So endet der wahrscheinlich größte Desillusionierungsroman des 19. Jahrhunderts, Flauberts L’Éducation sentimentale. Flauberts »peut-être bien« lässt Godard weg.
Mittwoch, 10.03.2010
Dienstag, 09.03.2010
Wirklich (komisches Wort)
Las Vegas, 1965, mit den Augen von Michael Pfleghar
Serenade für zwei Spione – einer jener Filme, über die man, wie Volker Pantenburg hier so schön vorschlug, schreiben sollte, bevor man sie sieht. 1965 fand der Spiegel: Mit seinem zweiten Kino-Film zerstört Michael Pfleghar („Die Tote von Beverly Hills“) die Hoffnung, ein Erneuerer des deutschen Films zu sein. 45 Jahre später, im winterlichen, und wie man mir erklärte, bekanntermaßen (!) ungeheizten Filmclub 813 siegten über die großen Erwartungen dann doch die unvorhersehbaren Kleinigkeiten: 1) Wie Hellmut Lange in einer offenen Straßenbahn durch San Francisco gondelt, während die Kamera parallel fahrend (in einem Kabrio?) vom angestrengten Lächeln des vernarbten Helden gelangweilt wegschwenkt, einfach mal so, nach vorne, in eine spektakuläre Stadtschlucht.
2) Wie Heidelinde Weis, in einer Regentonne badend, ihren Wunsch charmant artikuliert und rücksichtslos durchsetzt, Hellmut Lange nackt zu sehen. „Ganz! Sonst schreie ich!“
3) Wie eine Schießerei, nach wilder Verfolgungsjagd, auf dem Boden eines Bergsees – allerdings nur illusorisch unter Wasser, durch ein blubberndes Aquarium hindurch gefilmt – auf sonnigem Wüstenboden ausgefochten wird. Wirklich lustig ist was anderes.
Köln, 2013, mit den Augen von SPD und FDP (klein: die etwas dunklere „Sparversion“)
Nach neuesten Berechnungen ist der Leuchteffekt des fluoreszierenden „Siegerentwurfs“ teurer als geplant. Eine halbe Stunde der dargestellten Strahlkraft verschlänge in etwa die Energie einer gewöhnlichen Neutronenbombe. *
Wirklich traurig ist was anderes: Ende März schließt sang- und klanglos der ehemalige UFA-Palast (Riphahn/1931). In einer Januarnacht sah ich auf dem Ring bereits einen Fuchs über den verwaisten Bürgersteig laufen.