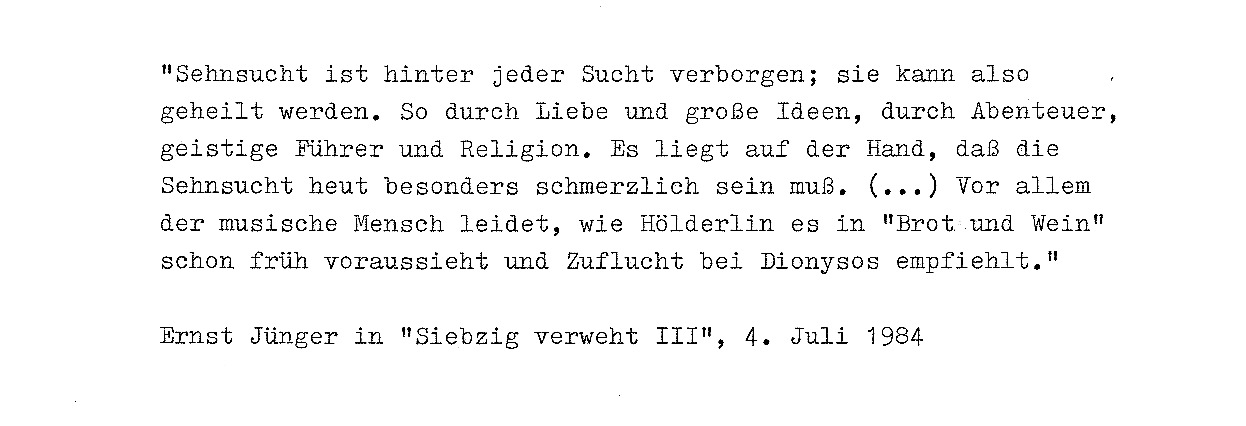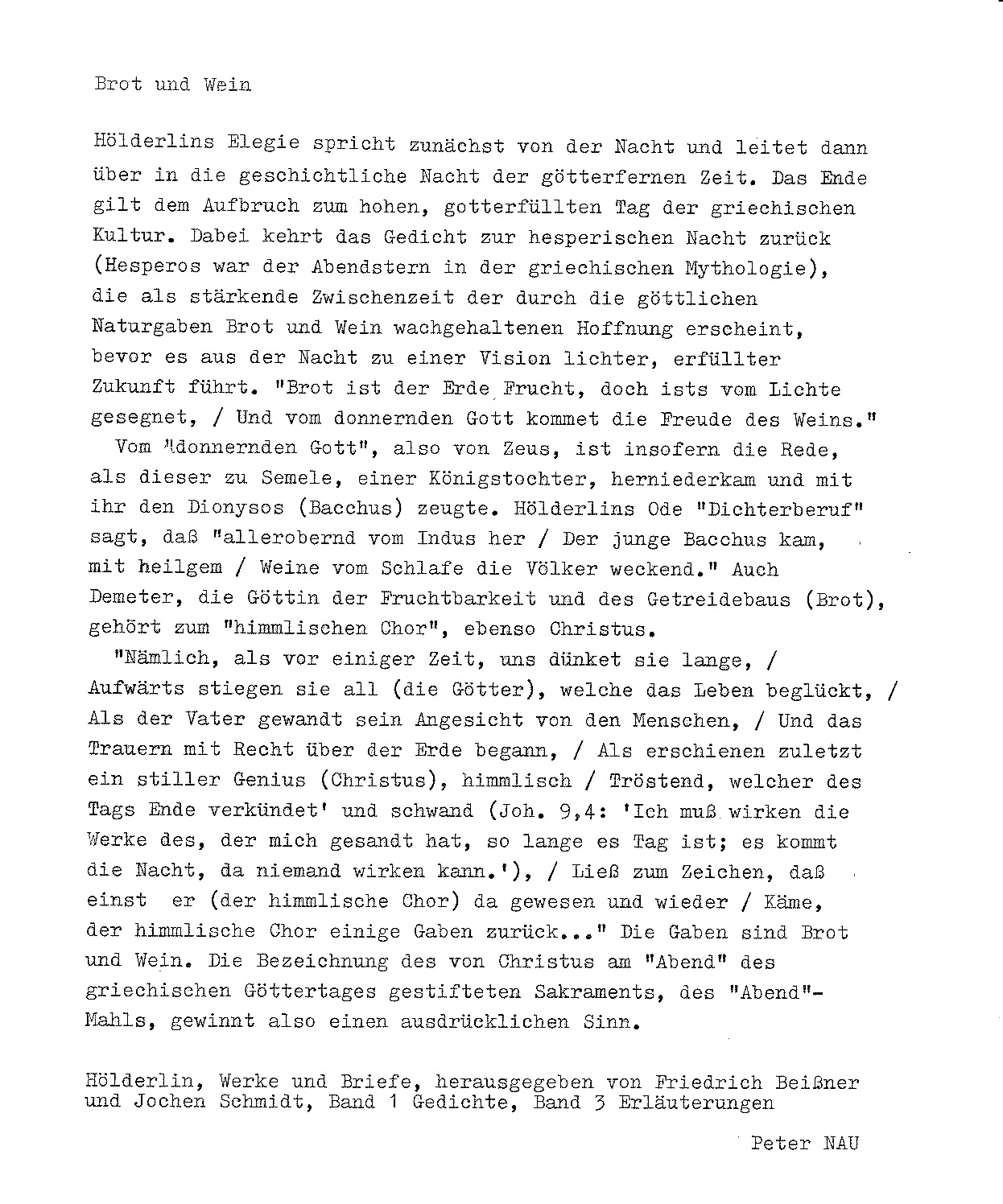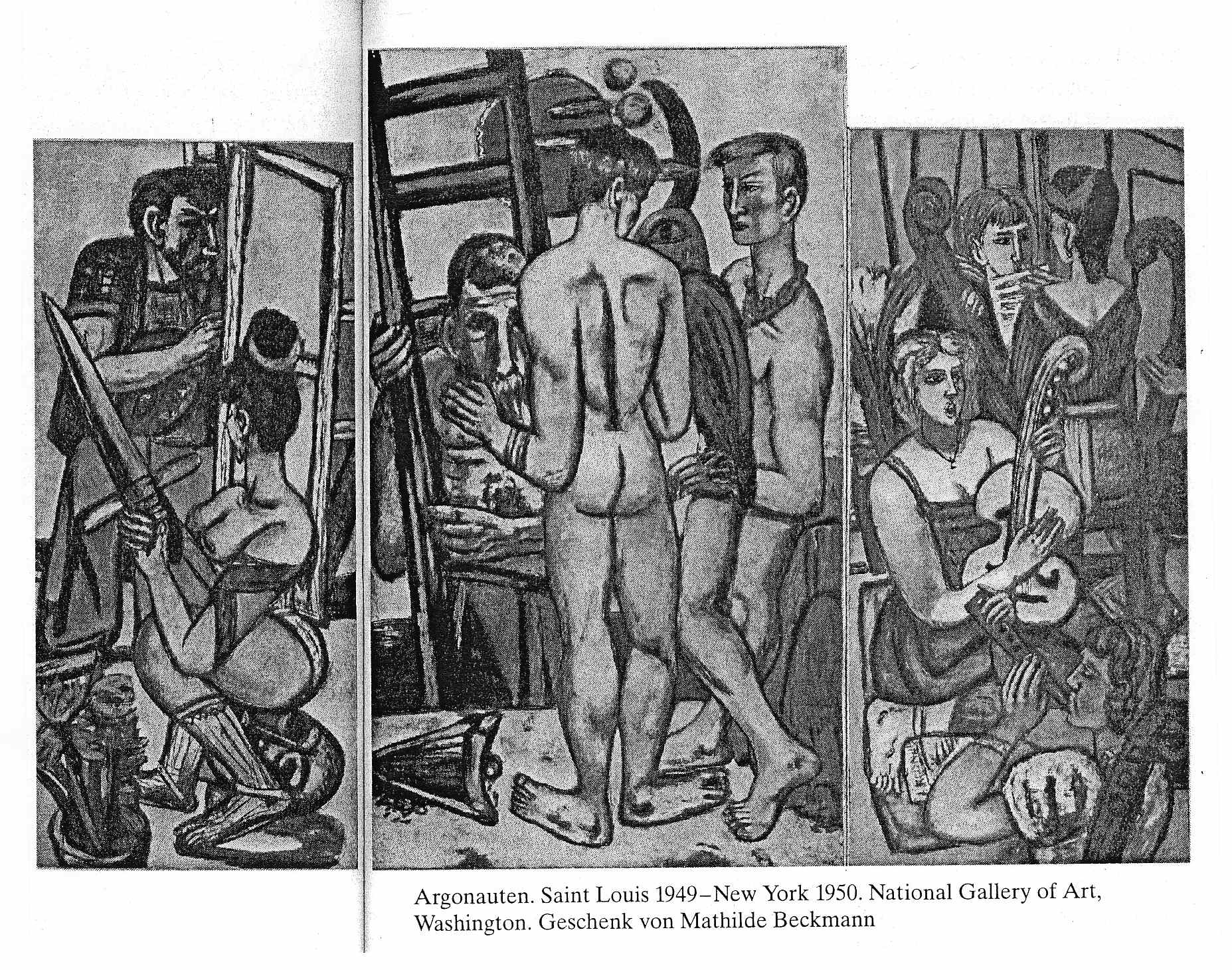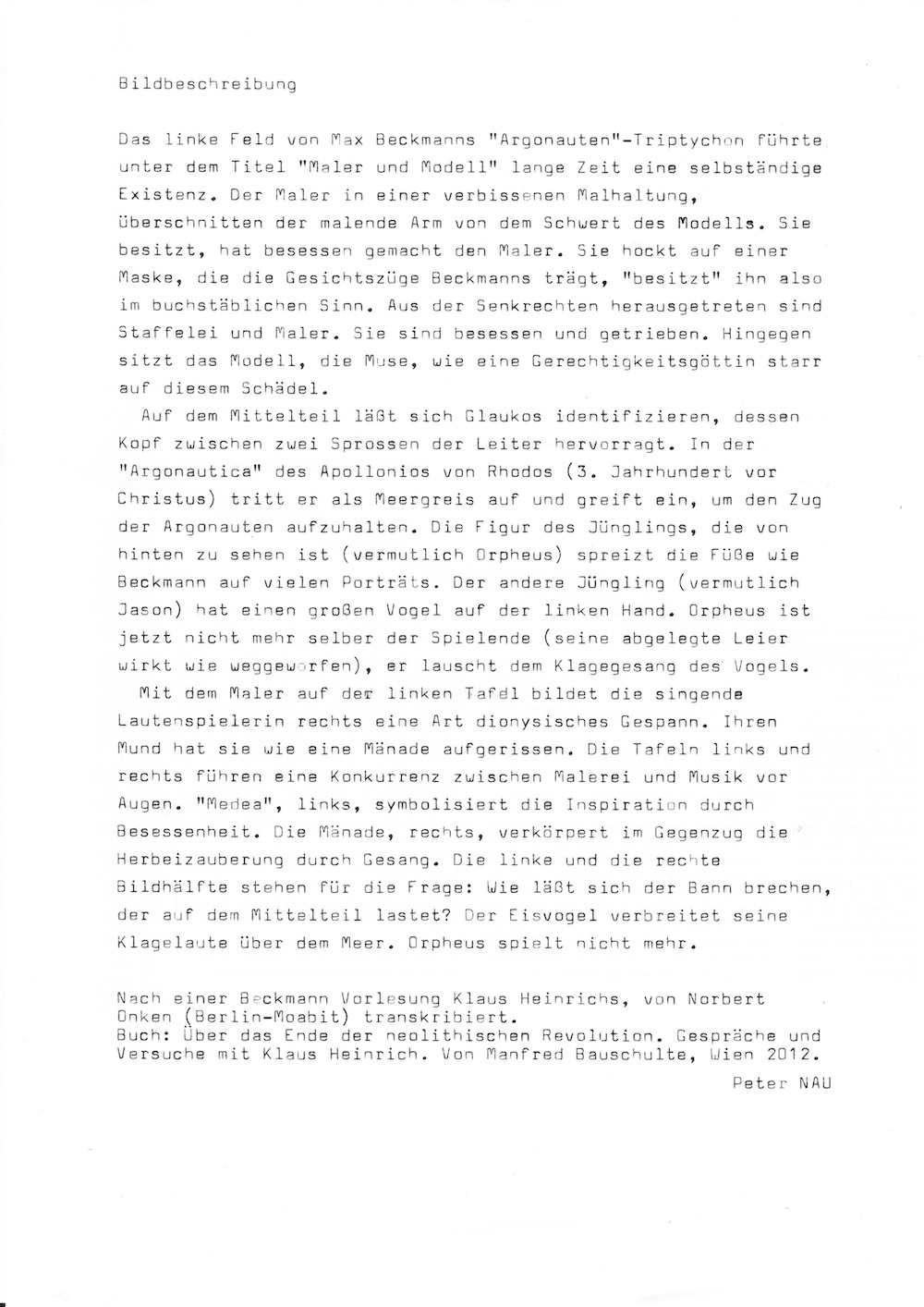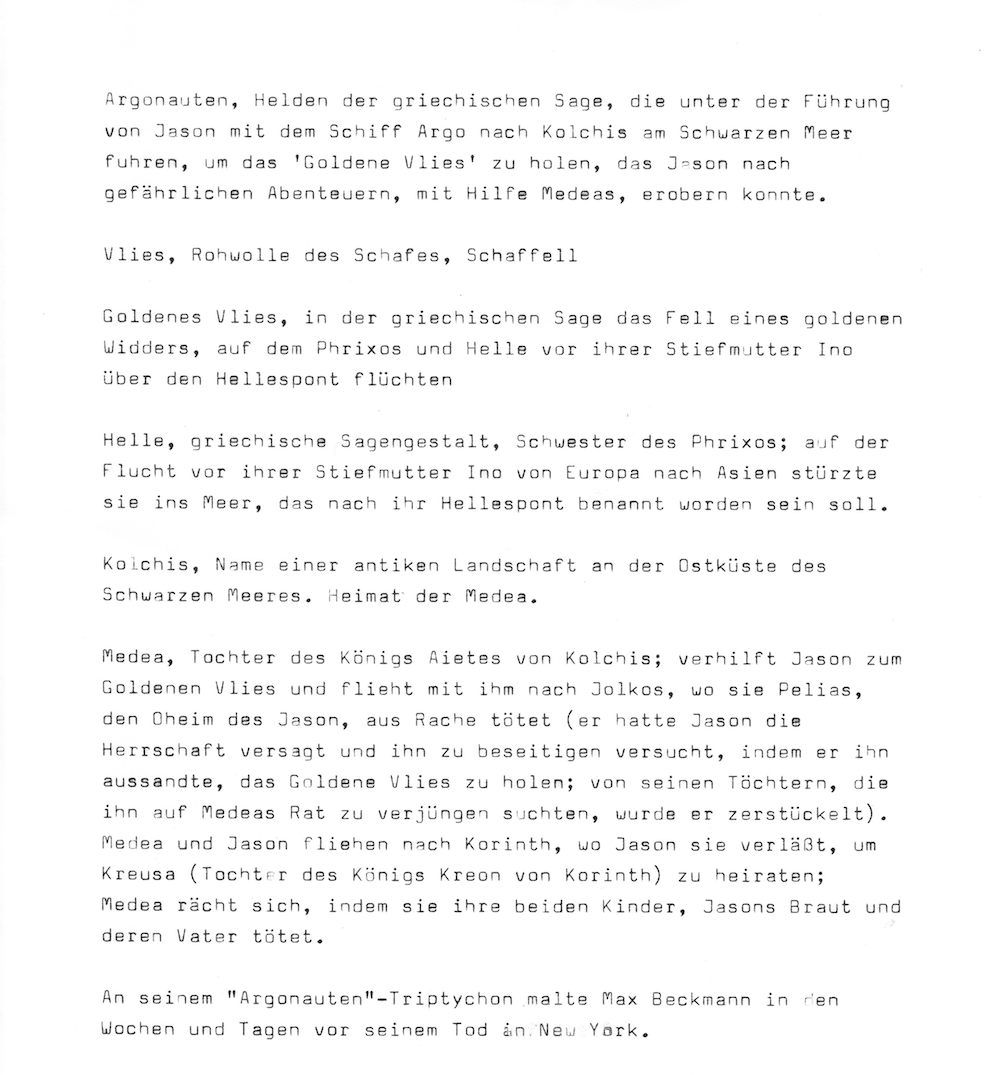2013
Montag, 05.08.2013
Sonntag, 04.08.2013
Barfuss und ohne Hut
Ein kurzer Film von Jürgen Böttcher: Prerow an der Ostsee, Sommer 1964. Jugendliche, im Urlaub, im Wasser und am Strand herumtollend, redend, sich abends um den Guitarristen und Sänger scharend, sich gegenseitig bewundernd, miteinander gehend, sich liebend – da sind Momente reinen Glücks, fast paradiesisch, versammelt. (‚Fast paradiesisch’ weil natürlich lange nach dem biblischen Sündenfall – gerne würde man einmal hören, wie die weibliche Perspektive auf den Sündenfall aussieht.) Das Meer, die Luft, die Sonne, der Tag, der sanfte Abend: man hat das Gefühl, so könnte es gehen, so wäre auch das Verhältnis der Geschlechter wieder im Lot … Nach dem Urlaub wartet allerdings wieder ein anderer Alltag, der von Beruf und Ausbildung, auf die Jugendlichen (über den sie auch Auskunft geben).
Barfuss und ohne Hut mutet wie eine Vorstudie zu Böttchers Spielfilm Jahrgang 45 an (DDR 1965/66). Und Peter Naus Text zu diesem Film (im gerade erschienenen Bändchen „Irgendwo in Berlin“) könnte man in einigen Passagen Zeile für Zeile übernehmen für den Barfuss-Film: „Schön ist das Licht in diesem Schwarzweissfilm (Kamera: Roland Gräf), da es als Tageslicht nicht nur den Ort sichtbar macht, sondern auch, indem es an den Tagesablauf gebunden ist, die Zeit spüren lässt. Der ganze Film ist wie ein einziger Sommertag, wie jene Reihe von schönen Tagen, von denen Adorno schrieb, daß sie uns glücklich macht, indem sie das Versprechen enthält, dass alles in Ewigkeit so weitergehen könnte, ohne je eine Trübung zu erfahren.“ Von „purer Lebensfreude“ ist da noch die Rede und davon, dass „die Menschen ihr innerstes Recht auf Werden“ behaupten.
„Ostwestlicher Filmdiwan“ nennt sich das Berlin gewidmete Bändchen im Untertitel, wo es doch bei Goethe so steht: „West-östlicher Divan“. Aber nein, bei Weg ohne Umkehr (dem Film von Victor Vicas von 1953) wird klar, dass Nau das von Gunter Groll hat, dessen damalige Kritik in der ‚Süddeutschen’ mit „Der ostwestliche Iwan“ betitelt war. Und da nun noch Naus Lieblingsschauspieler Ivan Desny die Hauptrolle spielt (allerdings ohne ‚w’), muss es sich so gefügt haben.
Dies alles wäre jetzt in Beziehung zu setzen zu dem, was da als Zweites steht in einer neuen Folge von Helmut Färbers „Das Grau und das Jetzt“:
„Der BRD ist geglückt bis auf den heutigen Tag, sich über sich selbst zu belügen.
Der DDR ist es missglückt; dabei sind ihre Mittel die unmenschlicheren und ihre Ziele die menschlicheren gewesen.“
(In: ‚manuskripte’, 200. Heft der Gesamtfolge, Graz, Juni 2013, S. 93. – Mit einem Dank an Michael Girke für die Übermittlung.)
Barfuss und ohne Hut in: „Spurensuche: DDR-Dokumentationsfilme im Abseits.“ Edition Dok Leipzig. Icestorm 2007.
Peter Nau, „Irgendwo in Berlin. Ostwestlicher Filmdiwan“, Berlin (Verbrecher Verlag) 2013.
Freitag, 26.07.2013
Die Regenschirme von Cherbourg
Auf TV 5 werden derzeit sonntags um 21 Uhr Filme von Agnes Varda und Jacques Demy gezeigt (Original ohne UT), am kommenden Sonntag das bezaubernde Musical „Les parapluies de Cherbourg“ (Die Regenschirme von Cherbourg, 1964) von Demy mit der fantastischen Musik von Michel Legrand. Am vergangenen Sonntag lief schon „Jacquot de Nantes“(1991) von Varda über ihren Ehemann und seine Jugend, in der er zum Film fand. Durch dieses berührende Werk erhalten wir viele Anhaltspunkte biographischer Art zum Verständnis seiner Filme. – Komisch und traurig ist die Szene, in der der todkranke Demy die Hauskatze – nicht sehr insistierend – vom Tisch verscheucht mit den Worten: „Laisse-moi ecrir!“ Dabei ist alles andere so unbarmherzig fühlbar, was ihn daran gehindert hat, den Film selbst zu machen und was ihn zwang, zu delegieren.
Mittwoch, 17.07.2013
Zwischen Lebenden und Toten
In Olivier Assayas neuem Film „Après Mai“ wird eine junge Frau, Leslie, in ein Haarlemer Museum geschickt, in dem sie sich zwei Bilder von Frans Hals ansehen soll. Der junge Mann will sie eigentlich begleiten, da der Grund der Reise nach Holland eine Abtreibung ist, was Leslie aber ablehnt. So gibt er ihr ein Buch des Dichters Paul Claudel in die Hand und weist sie auf einen Text darin hin, der die beiden Gemälde beschreibt. Zuerst können wir Zuschauer uns nicht recht vorstellen, dass Leslie dieser Empfehlung folgt, doch dann sehen wir sie, leider viel zu kurz im Museum. Es handelt sich offenbar um Spätwerke von Frans Hals. Über die Veränderung, die mit dem Menschen und Maler vor sich gegangen war, hat John Berger in „Das Leben der Bilder“(deutsch 1981) einen erschütternden Text geschrieben „Frans Hals und der Bankrott“. Der französische Dichter Paul Claudel hat in seinen Schriften über die Malerei die Grenze beschrieben, die durch die holländische Malerei und diesen Künstler auf seine ganz besondere Weise bezeichnet wurde. „Grenze zweier Welten! Finden wir sie nicht auf einer anderen Ebene in den Museen wieder unter dem flüchtig spiegelnden Glanz und Firnis, wenn wir unsere schwankende Gegenwart gegen jene Bildnisse halten, die die Kunst am Fenster der Vergangenheit zur Starre gebannt hat…Zwischen Lebenden und Toten ist dank dieser Abdrücke der Verkehr noch nicht eingestellt.“
Als Leslie zurückkehrt, weist sie die Berührung ihres Freundes zurück, ihr Blick, der früher vor allem auf eine verwöhnte Weise unbestimmt war, scheint sich jetzt illusionslos auf das zu besinnen, was ihr noch möglich ist. Sie hat sich entschlossen, in die USA zurück zu gehen und ihr Studium wieder aufzunehmen. Für mich die traurigste Szene des Films, weil sie den Bankrott der Beziehung zeigt: Das was zwischen ihnen hätte entstehen können, wurde mit dem ungeborenen Kind zerstört.
Sonntag, 14.07.2013
Donnerstag, 04.07.2013
Überlebende
Ein Buch und ein Film, die in diesem Jahr herauskamen, widmen sich den sogenannten „Judenältesten“ in den Konzentrationslagern, über die noch immer zu wenig bekannt ist, die aber oft der Kollaboration verdächtigt wurden. Über einen von ihnen hat Hans Dieter Arntz nun eine umfangreiche Dokumentation vorgelegt: „Der letzte Judenälteste von Bergen-Belsen. Josef Weiss – würdig in einer unwürdigen Umgebung“ (Helios, 2013). Arntz schreibt in seinem 2012 abgeschlossenen Werk, beklagend: „Claude Lanzmann drehte 1975/76 für seinen Dokumentarfilm „Shoah“ auch in Rom und führte ein langes Gespräch mit dem Rabbiner Dr. Benjamin Murmelstein. Die wissenschaftliche Auswertung hätte schon damals das begründete Selbstverständnis eines Judenältesten konstatieren können. Aber das wurde leider unterlassen.“ Inzwischen hat Claude Lanzmann den Dokumentarfilm „Der letzte der Ungerechten“ über Murmelstein beim Festival in Cannes vorgestellt. Er sagte dazu in einem Interview, gefragt, ob der Film eine Rehabilitierung leisten könne: „Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Man ist mit Benjamin Murmelstein sehr ungerecht gewesen. Es geht um eine Wiedergutmachung, die ich leisten will. Der Film zeigt, dass es nicht die Juden waren, die ihre Brüder ermordet haben…“ (FAZ, 27. Mai 2013)
Die ersten Fragen, die Lanzmann Murmelstein gestellt hatte, waren „Warum wurden die Judenältesten mehr gehasst als die Nazis?“ und „Warum leben Sie?“. Diesen Fragen geht auch Arntz in seinem Buch nach. Der Überlebende erscheint verdächtig. Er zitiert einen Häftling aus Bergen-Belsen, Werner Weinberg: „In seinem Buch „Wunden, die nicht heilen dürfen“ vertritt er die Ansicht, dass das Holocaust-Überleben zeitlich unbegrenzt und negativ klassifiziert ist: ‚Ein Überlebender des Krieges ist ein Veteran…Aber ein Überlebender des Holocaust ist geradezu ein Widerspruch in sich selbst, denn ein Ganzopfer lässt keine Überreste…’“
Samstag, 29.06.2013
Filme der Fünfziger XI: Ich suche Dich (1955/56)
Keiner war so beliebt wie O. W. Fischer, keiner strebte mehr nach ideellen und materiellen Werten. „Ich führe in Deutschland ein recht einkömmliches Leben,“ schrieb Fischer 1955 an Paul Kohner. Für zwei Filme im Jahr bekam er 350.000 DM steuerfrei – er bestand auf Auszahlung der Nettogage. Dazu kamen pro Film 10% des Weltertrags = 200.000 DM. Und wenn er selbst Regie führte, stieg die Beteiligung von 10% auf 25%. 1955 führte er zweimal Regie: für „Hanussen“ und „Ich suche Dich“. Dafür bekam er, folgt man seinen Angaben, 2 x 675.000 DM. Um das in die richtige Relation zu bringen, muss man wissen, dass das durchschnittliche Jahreseinkommen 1955 in der BRD 4.548,- DM betrug. Das aber brutto.
Fischer sah sich als “einen Mann, dem es gelungen ist, nach höchst deprimierenden Nachkriegsfilmjahren jenem Fähnlein von Künstlern anzugehören, deren andauerndes, zähes Tauziehen um die Hebung unseres Filmniveaus zu den ersten Anfangserfolgen geführt haben.“
Die prätentiöse, sich in falscher Bescheidenheit gefallende Sprache, deutet schon an, welche Höhen der Fähnleinführer diesmal erreichen wollte. Mit „Ich suche Dich“, nach einem in den 40er Jahren entstandenen Theaterstück des englischen Romanciers A.J. Cronin, hatte Fischer schon auf der Bühne großen Erfolg gehabt. Cronin selbst war der gebildeten, christlichen Hausfrau – die Männer lasen eh nur Zeitung – spätestens durch den Bestseller „Hinter diesen Mauern“ ein Begriff.
„Das Kernthema des Stoffes ‚Ich suche Dich‘“, erklärte Fischer vor der Premiere, „ist die große, tiefgreifende Liebesbeziehung zwischen einem Mann, der an seine Wissenschaft, und einer Frau, die an ihren Gott glaubt. Dieser Konflikt – wenn ich ihn auf ein Schlagwort bringen darf – zwischen ‚Glauben‘ und ‚Wissen‘ scheint mit einer der bewegenden Kräfte unserer Zeit zu sein. Ich habe versucht, ihn in einer sehr privaten Geschichte sichtbar zu machen.“ Oder, um es kürzer und noch schlichter zu sagen: “Glauben gegen die Hybris unserer Tage“.
Das war allerdings ein genuin deutsches Thema. „Land des Glaubens, deutsches Land“ sollte 1950 eigentlich die neue deutsche Nationalhymne werden – sie wurde es nicht, aber sie fasste die innere Haltung der Bundesrepublik gleichsam in den Ährenkranz der Unantastbarkeit. Fischer war ihr hoher Priester.
Dr. Paul Venner (O.W. Fischer) arbeitet in einem Nervensanatorium an einem Serum, das die Gehirnzellen reaktivieren soll. Der Schauspieler flattert in seiner ersten Szene als genialisches Wesen an Dr. Françoise Maurer (Anouk Aimée) vorbei – mit offenem Kittel, unrasiert und von seinem Genius gehetzt. Francoise Maurer, voll des christlichem Glaubens an das Gute, will in der Klinik Geld verdienen, um nach Indochina zu fahren und dort den armen, armen Menschen helfen zu können. Venner ist auf dem Weg zu seiner bahnbrechenden Entdeckung; er hat keine Zeit für Liebe, Mitleid und diesen ganzen Frauenkram. Gerade hat er das Verhältnis mit Gaby Brugg (Nadja Tiller) beendet, der Ehefrau des Chefarztes. Tiller schwebt und schwirrt als erotischer Brummkreisel durch den Film und setzt aus Eifersucht und Dummheit das Labor in Brand, in dem Venner seine Zauberformel notiert hat. Francoise, inzwischen mit Venner geistig ganz eng liiert, rettet die Formel aus dem Feuer und opfert ihr Leben für den Herrn und die Wissenschaft. Nun erkennt Venner seine wahre Berufung, er pfeift auf die bevorstehende Karrier‘ und fährt auf dem Pferdeschlitten nach Indochina, dem imaginären Land des Glaubens und der Innerlichkeit. Mit Kutscher, versteht sich.
Fischer konstruiert platte Gegensätze: Sexuelle Bedrohung gegen christliche Aufrichtigkeit, Hinterhältigkeit gegen Ehrlichkeit, kommerziellen Ehrgeiz gegen die Weisheit des Alters, Big Band Musik gegen Chopin, das Genie gegen die Kretins. Er inszeniert seine Verachtung der Welt-Wirklichkeit, die nicht erkennt und nicht bewundert, wie sehr er an ihr leidet, wie sehr er kämpft, um einer echten Auseinandersetzung zu entgehen. Es braucht ein zweifaches Frauenopfer (Tiller wird in eine Heilanstalt expediert), um dieser Welt „Adieu“ sagen zu können. Kameramann Richard Angst gibt ihm dazu elegante, gelegentlich auch magisch verhauchte Bilder – alles vergeblich.
Bei einer Pressekonferenz in Hamburg – Fischer kam gerade von der umjubelten Premiere in Hannover – gingen die Kritiker ihn hart an. Fischer war nahe dran, die Pressekonferenz abzubrechen. Der Schauspieler Paul Bildt setzte sich in höchster Erregung für seinen Regisseur ein und erlitt daraufhin eine Herzattacke. Die „Star-Revue“ (Nr. 6/1956) schrieb: „O.W. Fischer diskutierte nun – bei einem Glase Milch – friedlich mit den weintrinkenden Journalisten.“
Der Film war bei der Premiere ein riesiger Erfolg, aber letztendlich kein Geschäft. Fischer ließ die Filmregie sein. Aus Einsicht, aus Verachtung für die schnöde Welt oder nur, weil die Prozente so mager ausfielen – wer weiß?
Erhältlich auf DVD
Die Fischer Zitate stammen aus dem Presseheft zu „Ich suche Dich“ und aus Fischers Beitrag „Geld oder Gewissen“ in Film Revue, Nr. 13, 1956; die Gagenangaben machte Fischer in einem Brief an Paul Kohner vom 1.8.1955 (Paul Kohner Archiv – SDK)
Freitag, 28.06.2013
Kinohinweis Berlin: ORG
Samstag und Sonntag im Arsenal: ORG
Vor 15 Monaten hatte ich schon mal von ORG geschrieben. Volker Pantenburg, Stefan Pethke und ich waren auf den Film bei Archivrecherchen zu unserem 1978-Projekt gestoßen, dessen Fokus sich daraufhin auf ORG verschob. In der Zwischenzeit sind ein paar Sachen mit dem Film geschehen, die wir am Samstag und Sonntag im Berliner Arsenal vorstellen.
Am Samstag wird ORG nochmal vorgeführt, um 18.00 Uhr im Arsenal 1. Zu Gast ist da Settimio Presutto, der als Regieassistent Birris während der zehnjährigen (Post-)Produktionszeit an dem Film mitgearbeitet hat. Es gibt diesmal deutsche Untertitel, die wir während der Projektion einklicken werden.
Am Sonntag um 19.00 Uhr im Arsenal 2 hat ein Video-Essay zu ORG Premiere, den Anna Christine Antz, Philippe Crackau und Olga Galicka (von der Goethe Universität Frankfurt am Main) sowie Lucie Biloshytskyy, Zijian Guo, Markus Hörster und Eveline Jakubietz (von der HBK Braunschweig) unter Stefan Pethkes und meiner Leitung im April 2013 realisierten. Die Autoren werden anwesend sein, Volker Pantenburg moderiert die Veranstaltung. Zum Schluss gibt es noch einen Überraschungsfilm von 1951.
Dienstag, 25.06.2013
Zwischen Nacht und Licht
Bressons Verfilmung von Bernanos „Tagebuch eines Landpfarrers“(1950) ist beim Wiederanschauen – nach nochmaliger Lektüre des Buches – von einer immer wieder erstaunlichen Radikalität – und geradezu grausamen Treue. André Bazin schrieb darüber:
„ Bressons Treue zu seiner Vorlage ist jedenfalls nur das Alibi für eine Freiheit, die sich mit Ketten schmückt; er respektiert den Buchstaben, weil er ihm dienlicher ist als nutzlose Freiheiten, weil dieser Respekt letzten Endes, mehr noch als eine erlesene Last, ein dialektisches Moment in der Schöpfung eines Stils ist.“
Im Dunkel des Beichtstuhls erlebt der Pfarrer eine Art „Erscheinung“, aber von einer tatsächlich anwesenden Person. Das Gesicht einer jungen Frau, Chantal, die sich mit Selbstmordgedanken trägt, beginnt ihm, „nach und nach, stufenweise zu erscheinen. Dort verblieb es vor meinen Augen in wunderbarer Unbeständigkeit, und ich hielt atemlos still, als ob die geringste Bewegung es hätte auslöschen können. Übrigens machte ich die Beobachtung nicht in jenem Augenblick, sie kam mir erst hinterdrein. Ich frage mich, ob diese Art von Gesicht nicht etwa mit meinem Gebet in Verbindung stand, ob es nicht gar eben mein Gebet selbst war.“ Bei Bresson wird diese Verwandlung ganz schlicht gezeigt, so dass Chantals Gesicht wie ausgeschnitten ist, vom Körper getrennt, wie für einen Moment der Betrachtung herangeholt. Wie Bazin schreibt: „zögernd zwischen Nacht und Licht…“
Die Darstellerin der Chantal, Nicole Ladmiral, die als Schauspielerin wenig erfolgreich war, beging – wohl auch aus diesem Grund – 1958 (mit 28 Jahren) Selbstmord.
(Ich danke Eta, die mich auf diese Szene im Buch von Bernanos hinwies, im Hinblick auf die Erforschung des lebenden Gesichts, das für einen kurzen Moment die Anmutung einer Ikone hat.)
Mittwoch, 19.06.2013
Super8-Filme von Harald V Uccello
Die so gut wie unbekannten Filme von Harald V Uccello sind einzigartige Gebilde: das spezifisch Farblich-Stoffliche des Super8-Materials und die Dimension des Tons legieren sich auf schöne Weise mit dem, was da gezeigt wird und wie es gezeigt wird. (Helmut Färber hat schon in einem Gespräch mit Karl Heil und Harald Vogl vom 27.9.1980 diese für ihn besonderen Qualtitäten des Super8-Materials angesprochen; siehe ‚Filmkritik’, Dezember 1980, S. 556.) Entscheidend war sicher auch der Entschluss zum spielfilmmässig Inszenierten – Motive etwa nach Samuel Beckett / Sylvia Plath, Hans Henny Jahnn, Georges Bataille, Patricia Highsmith, Voltaire (Dear Jimmy, Henny, Anabel, Only You, Güle Güle, 1978-1985) –, die sorgfältige Kamerarbeit von Harald Vogl, der mit diesen beschränkten Mitteln (z.B. was das Licht in Innenräumen angeht) wunderbare Einstellungsfolgen geschaffen hat. Die fixen und leicht bewegten Kadragen sind immer so, dass man gerne hinschaut – das Bildliche nimmt gefangen. Dann das Halluzinative der Tonspur: auf den Strassen, in der Stadt, ist der Autoverkehr von einer fast nervtötenden Präsenz, oft setzt eine Einstellung mit übersteuertem Ton ein (den die Automatik dann runterregelt) und jeder Einstellungswechsel und Schnitt ist natürlich von Tonsprüngen begleitet. (Ein Huillet-Straub-Effekt; die Aufnahmebedingungen mit Super8 erforderten anscheinend, je nach Gerät, den Einsatz der ‚Automatik’.) Das ist nun nicht mehr rückgängig zu machen und katapultiert diese Filme in eine Region, in der die Stimmungen des Lichts, die farblichen Nuancen, der Ablauf des filmisch Amalgamierten sich mischt mit diesem Halluzinativen – wie wenn in all diesem einmal gegenwärtig Gewesenen nur immer die neue Gegenwart aufgerufen würde.
Die „Motive“ (nach den genannten Autoren) gehen so in die Filme ein, dass sie mal mehr mal weniger bemerkbar sind: wichtiger scheint, dass da eine bestimmte Figurenkonstellation entsteht oder hergestellt wird. Die als Darsteller verpflichteten Freunde, Nahestehenden, Personen machen sich diese Konstellation zu eigen – bringen jedoch (kommt einem vor) auch ihre persönliche Ausgangslage mit rein. Sie sind Darsteller ihrer Figur und ihrer selbst. Über diese Doppelung erhalten sie eine eigenartige Präsenz – und zwar alle, ausnahmslos, auch diejenigen, die nur kurz auftreten und wenig oder nichts sagen. ‚Eigenartige Präsenz’ ist wörtlich zu nehmen: sie sind wirklich da in ihrer Art, der Eigenart ihrer Person. Das Fiktive geht völlig im Dokumentarischen auf – oder eher: eins ist ganz im andern aufgehoben.
Ein kleiner Schritt noch (davor oder danach) und die Darsteller sind nur noch sie selbst: bringen sich ein als Person, tragen etwas vor von sich oder extemporieren vor der Kamera (Mono von HVU, 1979, Mmh von Karl Heil, 1981). Das sind immer auch kollektive Werke, in denen ein Raum organisiert oder zur Verfügung gestellt wird (von dem, der den Film macht), der dem Ausdruck dieser Personen dient. Und ein weiterer Schritt: beim letzten Super8-Film – Aufnahmen in Turin und Branca Leone (Kalabrien) – werden keine ‚Motive’ gesucht, es genügt, dass die Bücher von Cesare Pavese im Kopf des allein Reisenden und Filmenden vorhanden sind (Settanta Panini a Roma, 1985).