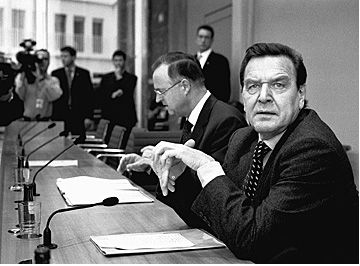Harun Farocki, Kriegstagebuch
(Zuerst veröffentlicht in der WoZ)
18.3.03
1944 machten Aufklärungsfotografen der US-Luftwaffe Aufnahmen von den Anlagen zur Herstellung von synthetischem Gummi und Benzin in Monowitz / Polen. Ohne es zu wollen und ohne es zu bemerken, erfassten sie dabei auch einige der Lager von Auschwitz. Diese Bilder wurden erst 1977 veröffentlicht. Die zuführenden Bahngleise lassen sich identifizieren, eine Wand, an der Exekutionen vorgenommen wurden, das Haus des Kommandanten, selbst die Schächte auf den Dächern der Gaskammern, durch die das Zyklon-B geworfen wurde, zeichnen sich ab. In der Distanz von 7000 Metern ist der einzelne Mensch kaum mehr als ein Bildpunkt, Menschen in Gruppen sind als Muster erkenntlich, eine Gruppe bewegt sich von den Bahngleisen zum Lager, eine andere steht in einer s-förmigen Windung auf dem Hof Schlange, um registriert zu werden. Eine dritte bewegt sich zur Gaskammer beim Krematorium 4, das Tor zum Hof steht schon offen.
Diese Bilder schienen mir damals ein angemessenes Mittel zur Darstellung der Lager, weil sie zu den Opfern eine Distanz halten. Anders als die Bilder aus der Nähe: Bilder von der Selektion auf der Rampe, Bilder der ausgehungerten Häftlinge in den Schlafräumen, der Leichenberge, die der Bulldozer wegräumt. Mit solchen Bildern wurde den Opfer noch einmal symbolisch Gewalt angetan und auch bei bester Absicht wurde von Ihnen ein Gebrauch gemacht.
Mit dem Krieg der Alliierten gegen den Irak wurde aus den Luftbildern ein alltägliches Mittel der Berichterstatung. Die TV-Stationen wurden mit schwarz-weissen Bildern mit dem Fadenkreuz im Zentrum überschwemmt, die entweder die Aufsicht auf ein Ziel gaben, in die ein Projektil einschlug. Oder die aus dem Kopf eines Projektils übertragen wurden, die den Anflug auf ein Ziel zeigten, bei dessen Erreichen das Bild abriss. Von diesem Bildern sagte Virilio, sie zielten auf uns.
Diese Bilder sind eine Propaganda neuen Typs. Sie sehen sachlich aus – wie ein technischer Vollzug – und unterschlagen, dass es viele menschliche Opfer in diesem Krieg gab. Es ist auch bezeugt, dass es Bilder gibt, auf denen Menschen im Zielgebiet zu sehen sind – aber das ist kaum zu beweisen. Die Bilder werden vom Militär erzeugt wie kontrolliert. Kriegs-Führung und –berichtersattung fallen hier zusammen.
Die Gegenseite hat ebenso Gründe gehabt, die menschlichen Opfer nicht zu zeigen.
Das soll nicht heissen, dass man die Bilder der Verletzten und Toten hätte zeigen sollen. Es ist nur zu deutlich, dass uns diese Bilder nicht aus guten Gründen erspart bleiben. Als Bush am 16.3. auf den Azoren den Giftgas-Angriff der irakischen Führung ansprach, gab es auf einmal Bilder von Toten auf den Strassen von K. zu sehen.
Schreckliche Bilder – vor 17 Jahren aufgenommen, als der Irak noch den Iran bekämpfte und von den USA unterstützt wurde – jetzt ausgespielt wie ein Trumpf.
In Tagträumen habe ich oft gedacht, dass ein guter Text, eine gute Fernseharbeit auf die vielen schlechten Texte und Bilder angewiesen ist, von denen sie sich absetzen will. Sind die guten Autoren nicht Ausbeuter der schlechten, so wie die hochqualifizierte Arbeit als Unterfutter die massenhafte, ungelernte braucht? Wenn es um den Krieg geht, wie kann man da beim Schreiben oder Filmen vermeiden, mit den entstellten Körpern Geschäfte oder Politik zu machen.
19.3.03
Zur Wappnung ein paar Worte von Serge Daney: „Das Bild steht immer an der Front der Auseinandersetzung zwischen zwei Kraftfeldern, es ist dazu verdammt, eine bestimmte Andersheit zu bezeugen, und es fehlt ihm immer etwas, obwohl es stets einen harten Kern besitzt. Das Bild ist immer mehr und zugleich auch weniger als es selbst.“ In ernsten Zeiten sind dumme Bilder und Wörter schwer zu ertragen. Die dummen Bilder sind nicht solche, die ihr Ziel verfehlen und etwas anderes treffen – in Analogie zu den „dummen Bomben”, die schon zum geflügelten Wort geworden sind.
„Um mir das Leben nicht weiter zu komplizieren, entschloss ich mich, zwischen dem „Bild” und dem „Visuellen” eine klare Unterscheidung zu treffen. Unter dem Visuellen verstehe ich die optische Verifikation eines rein technischen Funktionierens. Das Visuelle kennt keinen Gegenschuss, ihm fehlt nichts, es ist abgeschlossen, kreisförmig in sich zurücklaufend, ein wenig von der Art des pornografischen Spektakels, das nichts weiter ist als die ekstatische Verifikation des Funktionierens der Organe.”[*]
[*] Serge Daney, Von der Welt ins Bild – Augenzeugenberichte eines Cinephilen. Aus dem Französischen von Christa Blümlinger, Dieter Hornig, Silvia Ronelt, Herausgegeben von Christa Blümlinger, Verlag Vorwerk 8, Berlin, 2000
20.3.03
Im Kino und Fernsehen ist der Tod – radikaler noch als im Seelenleben – der Tod der anderen. Ich bin der Betrachter – ich sehe andere sterben, aber der Film wird weitergehen oder sich fortsetzen, also werde ich ewig leben. In Kriegszeiten kann ich die Bilder, die ich gerade gesehen habe, gleich nochmals auf dem gleichen Kanal oder einem anderen sehen. In einer Kolumne einer Filmzeitschrift hat Handke einmal von der Erfahrung mit billigen Nachtprogrammfilmen geschrieben, die in Rom begonnen werden und nach einer Insolvenz der Produktion in Berlin fortgesetzt werden. Nichts ist unheimlicher, als wenn Darsteller aus einer Filmerzählung spurlos verschwinden! Das ist der Erfahrung des Todes näher als das Bild eines Sterbenden, dessen Sterben, weil Wert in einem dramaturgischen Kalkül, auch noch etwas wie einen Sinn bekommt.
Am 11. September bemerkte ich, dass einem Moderator, der um die Mittagszeit in das Studio gekommen war, inzwischen Bartstopeln gewachsen waren. So etwas hatte ich noch nie gesehen und das belegte den Ausnahmefall besser als all die Beteuerungen, nichts werde mehr so sein wie bisher. Dass einem während der Fernsehsendung der Bart wächst, das ist so erschreckend wie dass einem nach dem Tod der Bart noch nachwächst.
21.3.03
Rache für den 11.9.: Jetzt haben die USA etwas in Gang gesetzt, von dem es nur ein paar Bilder gibt und die immer wieder gezeigt werden.
22.3.03
Ein Mail meines Freundes Rembert Hüser: ”Und warum schreibt oder sagt niemand, daß ‚awe‘ von ’shock and awe‘ nicht ‚Einschüchterung‘, sondern ‚Ehrfurcht‘ heißt? Daß es sich dabei um einen Begriff aus der Erhabenheitsästhetik handelt, daß es um die Anerkennung von Minderwertigkeit angesichts des Göttlichen geht?”
23.3.03
Ein Bild, wie ich es noch nicht gesehen habe. Start von Flugzeugen vom Deck eines Flugzeugträgers. Alle Gegenstände in leuchtenden Falschfarben, in niedriger Rate übertragen. Ein reales Bild, allerdings ohne jede Raumwirkung, wie icons auf einem display. Startende und landende Maschinen auf dem Flugzeugträger sind ein häufiges Motiv, das Standard-Stellvertreter-Bild für Kriegsführung, ähnlich dem von der Stahlschmelze für Industrie-Produktion. Zu oft gezeigt, ein neuer Ausdruck wird gebraucht!
Beim Zappen haben wir bemerkt, dass Viva sein Logo durch ein Ostermarsch-Zeichen ersetzt hat, zum Zeichen der Anerkennung sehen wir uns einen Clip an. Ein Rapper im Ghetto, mit teuren Kameras werden Effekte billiger Kameras nachgemacht, damit die Armut als Geste deutlich bleibt, wie bei einem Staatsmann, der das Gewand einfacher Menschen trägt. Auf den Rücken der Rapper erscheinen kurz elektronische Fadenkreuze. Ein Rebell zu sein heisst im Fadenkreuz der Hightech-Waffen zu sein. Zur Zeit des Kossovo-Krieges hielten in Belgrad Demonstranten Papp-Schilder mit einem Fadenkreuz hoch: wir sind die Opfer; daher muss die Idee für den Clip sein.