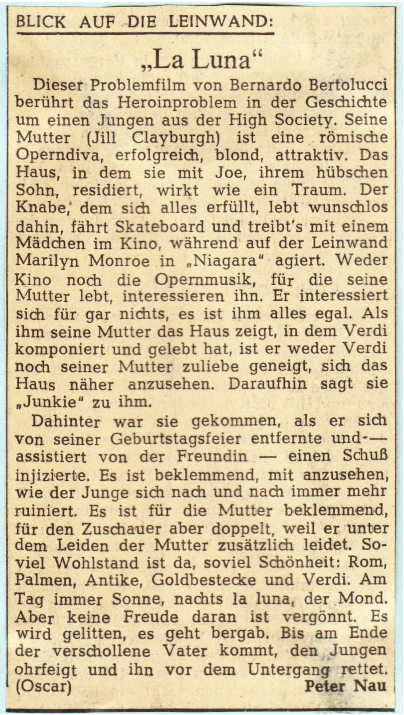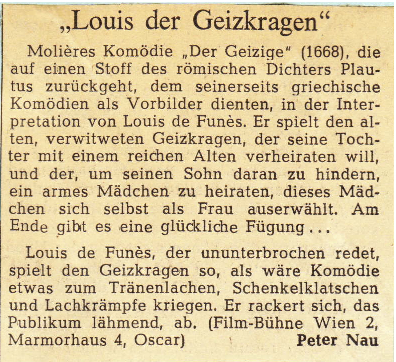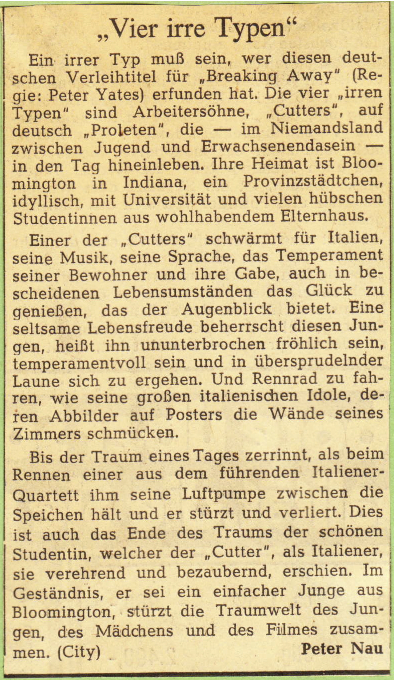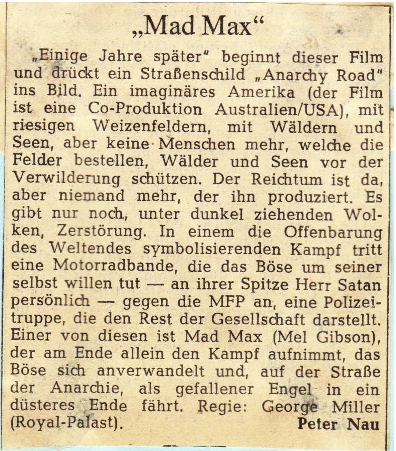Dienstag, 24.04.2012
Freitag, 20.04.2012
Dienstag, 17.04.2012
Kinohinweis (Berlin)
Über Wassilij Schukschin weiß ich wenig, ich verstehe kein Russisch, die Umschriften des Namens sind verschieden, Vasili Shuskin, Vasilij Šukšin… – solche Gründe. Fünf Filme hat er als Regisseur gemacht zwischen 1964-1974, 1974 starb er an einem Herzinfarkt (anderswo heißt es: Magendurchbruch). Er war Schriftsteller, Regisseur, Schauspieler. 2009 gab es eine Retro seiner Filme im ÖFM, auf deren Seite steht: „Als sich am 2. Oktober 1974 die Nachricht verbreitete, dass Vasilij Makarovič Šukšin im Alter von 45 Jahren an einem Herzanfall verstorben war, stand für kurze Zeit ganz Moskau still. Šukšin – Schriftsteller, Schauspieler, Regisseur – war die rarste Art von Filmemacher: der auteur als Volksheld. Jeder Sowjet-Bürger der 60er und 70er Jahre kannte ihn, seine Gestalt und seine Gestalten, und erkannte sich darin.” Weil entuziazm Teilnehmer des Living Archive Projekts ist und sich in diesem Rahmen um Archivzugänge im Jahr 1978 kümmert und weil 1978 seine Filme im Forum liefen, ist heute um 19.00 Uhr im Arsenal 2 „Shiwjot takoj paren” zu sehen, bei freiem Eintritt. BW, Mitglied der Ferroni Brigade, schreibt mir gestern von der Retro im Österreichischen Filmmuseum vor 3 Jahren, „die Hütte war – bei allen 5 Abenden – VOLL, man glaubt es nicht, und die Begeisterung war schlicht und einfach riesig.” Und: „Zivet takoj paren‘ ist dabei glaub ich mein Lieblingsfilm. Der ist noch nicht so ‚verbissen’”. Leider hat sie heute keine Zeit zu kommen. Im Wakeman steht, der Film sei „electrifyingly far from the predictable optimism of the average Soviet movie, presenting a hero who is a boastul and hard-drinking seducer, and the people he meets as ‚living lives of quite desperation’”. Mehr zu Schukschin und den Filmen findet man auf den 8 Seiten des Informationsblatt des Forums, ein pdf.
Samstag, 14.04.2012
Oliva Oliva (D/F 2006) von Peter Hoffmann im Regenbogenkino in Berlin, Sonntag, 15.4.2012, um 19.30
Das ist ein Film, der alles zuhilfenimmt, was er nur hat, um einen Aufenthalt in Spanien zu beschreiben: zehn Tage im August und eine Woche im September 1998 in der Extremadura und in Salamanca und Valero.
Was er hat (aus eigenen Mitteln), ist karg: Super8-Aufnahmen in Farbe und schwarz-weiss, Fotografien, O-Töne und ein Tagebuch, das vom Autor, Tag für Tag kommentierend, gelesen wird. Eine Arbeitssituation – nein: eine Lebenssituation – wird beschrieben: „die Welt der Imker“ – „die Arbeit in den Bienenständen und in der Werkstatt, Tag- und Nachtfahrten im LKW, mit Nono [einem Freund] unternommene Ämtergänge, auch einen Sonntagsausflug mit seiner Mutter in die Sierra de Francia, das Stadtfest von Salamanca und die anstrengenden Nächte in der Stadt …“ Peter Hoffmann hat nicht nur gefilmt, er hat sich in der spanischen Hitze auch an der Arbeit beteiligt.
Das ist alles ganz anders, als man es sich vielleicht so vorstellen mag: was man hier mitbekommt, ist ein bedrängtes, zwischenfallreiches, intensives Leben – immer „on the edge“, aber mit guten Momenten freundschaftlichen Zusammenhalts.
(Ausschnitte aus Las Hurdes von Buñuel zeigen, dass es auch da um die Imkerei ging: die Gegend grenzt an die an, in der Peter Hoffmann gedreht hat.)
Freitag, 13.04.2012
Dienstag, 10.04.2012
Samstag, 07.04.2012
Kinohinweis (Berlin) [Reklame]
Am Montag, 9. April um 19.00 Uhr, ist mein Godardloop erstmalig im Kino zu sehen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert, weil der Loop zum Angucken auf großen Bildschirmen konzipiert ist, nicht für große Leinwände.
Die Projektion ist digital im Moabiter Filmrauschpalast, Lehrter Str. 35, in der Reihe ab:sicht als Vorfilm zu Godards „Film Socialisme”. Eintritt 7,- Euro.
Es gibt zwei Wiederholungen: am 23.4., wieder ein Montag, nochmal mit „Film Socialisme”, und am 28.4. bei freiem Eintrtt mit Einführung und Paul Cronins „Film as Subversive Art: Amos Vogel and Cinema 16” und Plattenauflegen danach – filmrausch.de/
Nachtrag:
Anscheinend gibt es Codec-Probleme, so dass heute, 9.4., Godardloop (wie auch Film Socialisme) von DVD projiziert werden.
Freitag, 06.04.2012
Mittwoch, 04.04.2012
Filme der Fünfziger VI
1950 wurde die Schauspielerin Sonja Ziemann mit „Schwarzwaldmädel“ von Hans Deppe die beliebteste Filmschauspielerin Deutschlands; die Kinobesitzer liebten Sonja Ziemann und das Geld, das ihnen „Schwarzwaldmädel“ einbrachte. Ein Jahr darauf gelang der Berolina Film mit „Grün ist die Heide“ – wieder mit Ziemann in der Hauptrolle – ein noch viel größerer Erfolg. Alle waren verrückt nach dem Traumpaar Sonja Ziemann/ Rudolf Prack. Nun möchte man sich vorstellen, dass ein skrupelloser Agent – etwa so jemand wie der Romy-Stiefvater Blatzheim, dem in manchen Biographien auch noch schändliche Inzest-Gelüste nachgesagt werden – das Paar Ziemann/Prack in immer noch prächtigeren Schmonzetten verheizt. Aber es war alles viel banaler, denn es folgten zwei Filme, die gar nichts mit dem Heimatfilm, aber viel mit deutscher Befindlichkeit zu tun hatten.
Anfang der fünfziger Jahre scheint es Wohnungsnot gegeben zu haben; in der real-Film Produktion „Schön muss man sein“ (1950/51) schlafen Vater und Sohn Holunder (Willy Fritsch und Hardy Krüger) in einem Zimmer. Die beiden sind Komponisten und gute Kumpel. Sie führen ein flottes Junggesellen-Leben; die Küche ist eine groteske Schweinerei, das Wohnzimmer von Parties versifft – so wie Männer ohne Frauen eben leben. Anny Ondra spielt eine verzickte und dauerbeleidigte Operettensoubrette, Rudolf Platte einen verzweifelten Theaterdirektor. Der Film wurde von Akos von Rathonyi inszeniert. Die Biographie des Regisseurs, die man bei Wikipedia nachlesen kann, ist ungleich interessanter als seine Filme. In dieser Verwechslungskomödie versucht er einige Balletszenen nach Busby-Berkeley-Manier aufzulösen. Das geht in „Schön muss man sein“ genauso schief wie in „Maharadscha wider Willen“ (1950), gleichfalls eine Rathonyi-Inszenierung.
„Schön muss man sein“ ist kaum mehr als ein auf Länge getrimmter Herrenwitz. Ein „Irrenarzt“ untersucht Annie Ondra und stellt schwere seelische Störungen fest, Hans Richter schminkt sich auf Neger und färbt ab. Auf einen Farbigen ist die Zeile gemünzt „Ich sehe schwarz“. Lieder werden gesungen und das rrr wird gerollt – wir haben es mit echten Schauspielern zu tun. Hardy Krüger mit seiner Haartolle bekommt Sonja Ziemann als Braut, und Willy Fritsch geht leer aus.
Noch katastrophaler ist „Maharadscha wider Willen“, eine CCC-Produktion; ein Haarwuchmittelfabrikant (Kurt Seyfert) flieht vor seinen Kunden ins Ausland, in den Ort Zet. Dort gibt es einen Doktor, der die Haare zuverlässig wieder wachsen lässt, den man aber den ganzen Film über nicht zu Gesicht bekommt. Die Tochter des Fabrikanten (Sonja Ziemann) folgt dem Vater im Auto eines Maharadschah, der inkognito nach Zet fährt. Sein Sekretär ist Rudolf Prack. Interessant ist in diesem Film, dass man ohne Pass und Reisegenehmigung nicht über die Grenze kommt und dass Sonja Ziemann vor ihrem Vater einen Bauchtanz aufführt. Das gute am Inzest ist ja, dass er so bequem ist. Deshalb kommt er auch immer mal unter dem zeichen „Hoppla, das wär ja jetzt was gewesen“ im deutschen Film vor. Und ganz deutlich sieht man, dass Rudolf Prack als die bürgerliche Nachkriegsausgabe von Willy Birgel angelegt ist. Prack reichen als schauspielerisches Rüstzeug ein Anzug und ein steifer Rücken. Georg Thomalla hat eine Rolle als Attentäter. Das ist, zwei Jahre nach dem Tod von Gandhi, besonders geschmacklos.
Beide Filme wurden schon bei ihrer Uraufführung von der Kritik verrissen. Weil sie aber so lieb war, blieb Sonja Ziemann weiterhin populär und überstand diese Plotten, die für sie und andere gestrickt wurden.