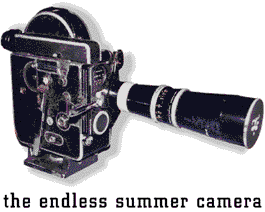Sehen und Sterben II
Liebe in Zeiten des Krieges
II. Weltkrieg; Häuserkampf in Frankreich nach der Landung der alliierten Truppen; zwei Männer im Nahkampf auf Leben und Tod wälzen sich am Boden einer Wohnung im ersten Stock einer Mietshausruine. Neben ihnen liegt ein röchelnder angeschossener amerikanischer Soldat im Sterben, der fürderhin nur noch eine Rolle als Hindernis einnimmt. In der Hektik des Kampfes gerät die Kamera immer wieder aus dem Lot. Der in diesem Augenblick noch sehr lebendige zweite Amerikaner, Private Mellish, kann die Oberhand in dem herrschenden Handgemenge gewinnen und zückt sein Messer gegen den Deutschen.
Private Mellish:
God! … God!
You damned … (unverständlich)
Aber das Glück wendet sich. Der deutsche Soldat kann den Amerikaner auf den Rücken werfen und ihm das Messer abnehmen, um ihn nun seinerseits damit zu bedrohen. Bald schon schwebt die Spitze des Messers über dem Herzen von Private Mellish, der kaum noch Widerstandskräfte mobilisieren kann.
Deutscher Soldat:
Gib auf! (fast unverständlich, dann aber en face und sehr deutlich mit süddeutschem Akzent)
Gib auf!
Du hast keine Chance!
Lass es uns beenden!
Die Messerspitze kommt immer näher und kratzt den Amerikaner ein erstes Mal ins Brustfleisch. Private Mellish gerät in Panik.
Private Mellish:
What’s up, what’s up!?
Stop it! Stop it!
Über einen Zeitraum von 40 Sekunden versenkt nun der deutsche Soldat das Messer im Herzen von Private Mellish, der nur nach Luft schnappen kann, manchmal röchelt und zu schlucken versucht. Schuss/Gegenschuss – der Deutsche untersichtig, en face – der Amerikaner liegend auf dem Rücken, also aufsichtig zu sehen, schräg über Kopf, Gesicht und eindringendes Messer immer gleichzeitig im Bild.
Deutscher Soldat:
Es ist doch einfacher für Dich!
Viel einfacher!
Du wirst sehen, es ist gleich vorbei.
Schschsch … schschsch … (wie, um ihn zu beruhigen)
Bei den letzten Lauten ist der Mund des deutschen Soldaten fast am Mund des Sterbenden. Schweiß trieft ihm vom Gesicht über die Nase, von wo er in Tropfen auf den Amerikaner fällt, der nunmehr tot ist. Der unbeteiligte Dritte verharrt seit geraumer Zeit regungslos neben den beiden, oft im Vordergrund des Bildes. Private Mellish liegt hingestreckt da wie ein vom Kreuz genommener Jesus unter dem deutschen Soldaten. Halb auf ihm liegend, halb aufgestützt betrachtet dieser sein Opfer. Die Szene ist unterschnitten mit mindestens drei weiteren Erzähleinheiten des in den Häusern und in den Straßen tobenden Kampfgeschehens. Im Bundeswehrjargon der hiesigen Privates (= Schützen) würde sie der Einfachheit halber unter der Überschrift GEFICKT laufen.
(SAVING PRIVATE RYAN, S. Spielberg, USA 1998, ca. ab 2:17:00)
HERZENSANGELEGENHEIT: Der vorangehend beschriebene Vorgang kann angesehen werden als Herstellung einer herzlichen Beziehung. Die nationale Krankheitspräferenz der Deutschen befindet sich im Bereich der Herz-Kreislaufprobleme. Da liegt die Vorstellung des Herzens als Motor und Pumpe nahe, aber auch die des Zentrums von Sentimentalität und Schwermut. Dass das Abstellen des Motors somit zu Erlösungszuständen führen kann, ist jedem einsichtig. Die Probleme der US-Amerikaner sind eher solche der Verdauung, die Vorstellungen des Herzens übersüßt. WILD AT HEART heißt es, und Stevie Wonder sang … from the bottom of my heart, diverse andere … directly from my heart to you/ … and what my heart has heard – well, it takes my breath away. Herz und Ekstase sind hier eng konnotiert. In einer INDIANA JONES Episode reißt ein Unhold in Ritualen seinen Opfern das Herz aus dem Leibe. Wenn man es mit dem Messer ansticht, kann man vielleicht am Herzblut partizipieren. Der deutsche Soldat kann nicht wissen, dass er es außerdem mit einem Juden zu tun hat. Regisseur und Drehbuchautor wussten Bescheid.
ZU-TODE-LIEBEN: Aus der komplementären Anordnung des Tötungsaktes zur beschwichtigenden Rede eines Vaters, der seinen Sohn zu Bett bringt oder zum Zahnarzt begleitet, oder zur Ansprache des Liebenden an den Geliebten, gleichzeitig aber auch der Drohgebärde des überlegenen Fremden an den Unterlegenen, der alles fahren lässt, sich überantworten muss, gewinnt die Szene ihre innere Gespanntheit und Morbidität, ganz abgesehen von der Obsession, die Tötung eines Menschen als Quasi-Snuff-Video unter dem moralischen Verdikt von historischem Realismus darstellen zu wollen. Diverse Veteranen müssen in der Begleitdokumentation wieder und wieder bestätigen, dass der Film das Authentischste, das Realistischste ist, was es auf diesem Gebiet gibt. Es war genau so. Gezeigt wird das, was uns in PEEPING TOM immer vorenthalten wurde, der Augenblick des Ablebens. So wie Spielberg die Außerirdischen dereinst in persona auftreten ließ, Juden unter Duschen zeigte, die sich in der Gaskammer wähnen, dann aber tatsächlich nur Wasser aus den Düsen kommt, übertritt er auch hier Grenzen, was ihm in diesem Fall sein Realismusanspruch zu gebieten scheint. Dabei kann aber weniger von einem Wagnis gesprochen werden, als vielmehr dem Versuch, das zunächst Unhintergehbare des Todes dingfest zu machen und zu instrumentalisieren. Verdinglichen selbst der Verdinglichung. Tod mit Sinn füllen. Das Versprechen einlösen. Zeigen, was wirklich ist. Rührt nicht die Faszination, dies ansehen zu dürfen, daher – wenn man nur genau genug hinsieht, bekommt man heraus, was das heißt ‚sterben’ und was jenseits der Schranke liegt? Besser, man sammelt seine Erfahrungen vorher, besser, man weiß Bescheid, man kann ja nie wissen.
Naive Vorstellung oder Kalkül, patriotische Selbstbespiegelungen könnten ohne Mythenproduktion funktionieren, wenn man sie nur einem ‚aufrichtigen, akribischen’ Realismus unterwirft. Und doch werden sie gewinnen. Godard hat darauf hingewiesen, dass PANZERKREUZER POTEMKIN mittlerweile als Dokumentarfilm eingesetzt und auch so gelesen wird, will man Authentisches über die Revolution erfahren. Es vermag „kaum zu verwundern, dass besonders Spielfilmen oder Fernsehserien in unseren Interviews die Rolle zukommt, als Belege für historische Wirklichkeit zu fungieren“ – so die Autoren einer sozialpsychologischen Studie zu Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis. (Welzer et al.: Opa war kein Nazi, Frankfurt/M 2002, S. 129) „Das Ereignis ist nicht das, was passiert. Das Ereignis ist das, was erzählt werden kann.“ (Allen Feldman, in: ebenda, S. 128) Und gleichzeitig das Erstaunen der Fernsehgenerationen, die schon wissen, wie ein Krieg auszusehen hat, und bei der Realität mehr Realität einklagen. So der etwas enttäuschte Bericht des 22-jährigen Offiziers Gary McKay aus dem Vietnamkrieg: „Es ist gar nicht so, wie man es normalerweise aus dem Kino oder dem Fernsehen kennt: kein fürchterliches Schreien der Verwundeten, nur ein Grunzen, und dann fällt er völlig unkontrolliert zu Boden.“ (Joanna Bourke: An Intimate History of Killing. Face-to-face killing in twentieth-century warfare, London 1999, S. 26, in: ebenda, S. 227) Einzig die Tatsache, dass es vom D-Day relativ viel Dokumentarmaterial gibt, mag vielleicht dem Ablauf Vorhalt gebieten, der SAVING PRIVATE RYAN automatisch in den Status authentischer Berichterstattung erhebt. Ein Fall wie HOLOCAUST macht da nicht viel Mut.