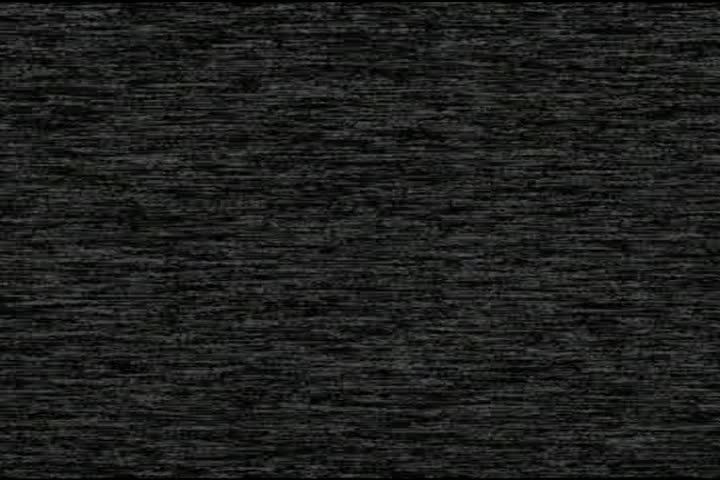Und wenn es sich im Sturme bewegte, so hatte er wirklich etwas Ossianisches
Eine weitere Flaschenpost aus dem heroischen Zeitalter des Öffentlich-Rechtlichen Fernsehens: 1969/70 konnten Filme vom WESTDEUTSCHEN RUNDFUNK in Auftrag gegeben, mitfinanziert, zwischen dem 23. September und 9. Oktober 1969 gedreht und am 1. Juni 1970 ausgestrahlt werden, deren Auszüge aus dem Drehbuch so klingen:
„1. Dem Kameramann stehen für die gesamte Drehzeit zur Verfügung: schwarze Schnallenschuhe, dunkelgraue Samthosen, hellgraue Handschuhe, zwei schwarze, mit Spitzen verzierte Samtärmelschoner, ein Hut, verschiedene Hörrohre, manuskriptähnliche Notenseiten, ein Konversationsheft zum gelegentlichen Kritzeln, Schreibzeug. […]
5. Seine Musik wird so klingen, wie Er sie 1826 noch hören konnte. Durchwegs schlecht.
6. Beethovenhaus, Wohnzimmer: Das Ensemble der Einrichtung soll wie mittelmäßiges Blendwerk für Besucher wirken; die Metallverkleidung des Wohnzimmers ist hier ein Akt vielfacher Musealisierung. […]
11. Fernsehsendung: Alle Ansager und Ansagerinnen sollen mindestens 65 Jahre alt sein und faltenreiche Gesichter haben. Im Gegensatz zur Fernsehenideologie des glatten Aussehens wären Greise hier die ideale Besetzung. Die nachfolgenden Sätze sind authentisch und belegbar: ‚Ich bitte um Geduld‘, ‚Die Welt hat ihre Unschuld verloren und ohne Unschuld schafft und genießt man kein…‘, ‚Was ich geworden bin, bin ich nur durch mich selbst geworden‘. […]
21. Der provinzielle Eindruck seiner Darbietung ist durch eine unglückliche Kameraeinstellung zu verstärken.
22. Fernsehschnellstkursus III: Klavierpädagogik. […]“
[Mauricio Kagel: LUDWIG VAN. EIN BERICHT (1969). Auszüge aus dem Drehbuch, Dezember 1968. Der Film, damals für das Beethovenjahr produziert, ist vor kurzem bei Winter & Winter auf DVD erschienen. Kagel war an Tranfer und Remastering beteiligt. Im Beiheft auch die vollständige Fassung der Auszüge aus dem Drehbuch. Mitwirkende an LUDWIG VAN: Joseph Beuys, Günther Böhnert, Carlos Feller, Werner Höfer, Mauricio Kagel, Rudolf Körösi, Linda Klaudius-Mann, Klaus Lindemann, Heinz-Klaus Metzger, José Montes-Bacquer, Diter Rot, Schuldt, Victor Staub, Otto Tomek, Ferry Waldoff, Stefan Wewerka.]