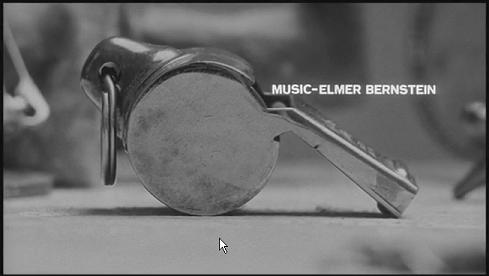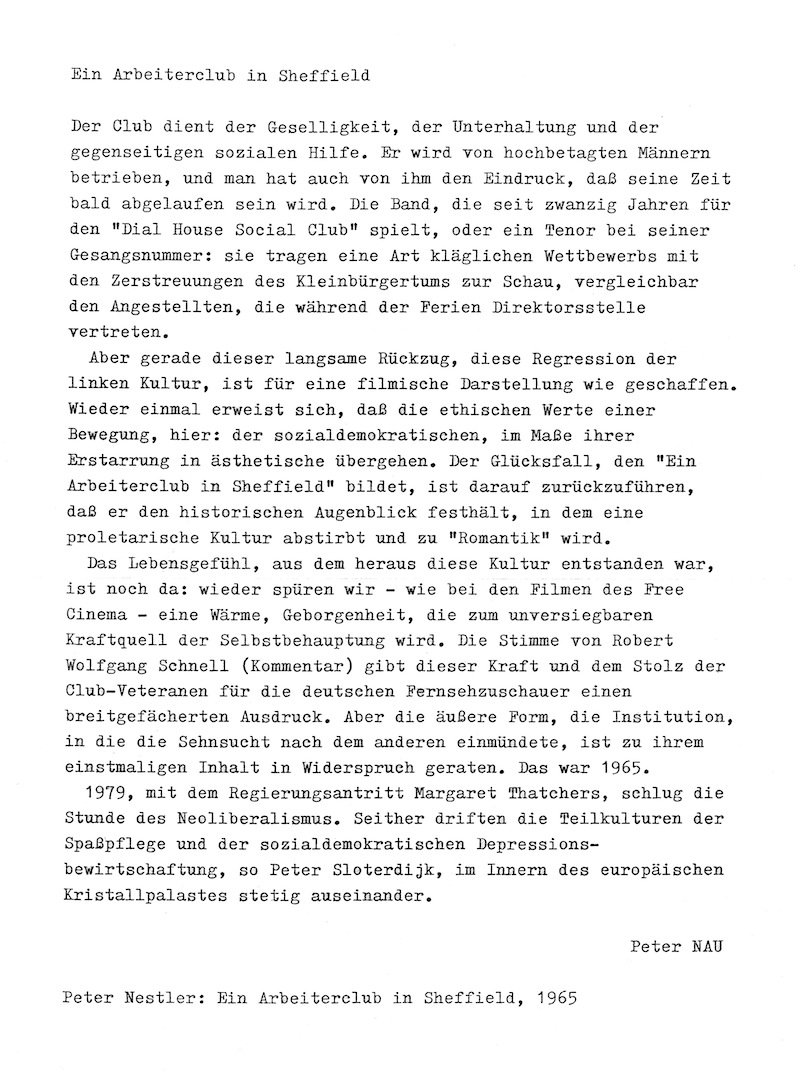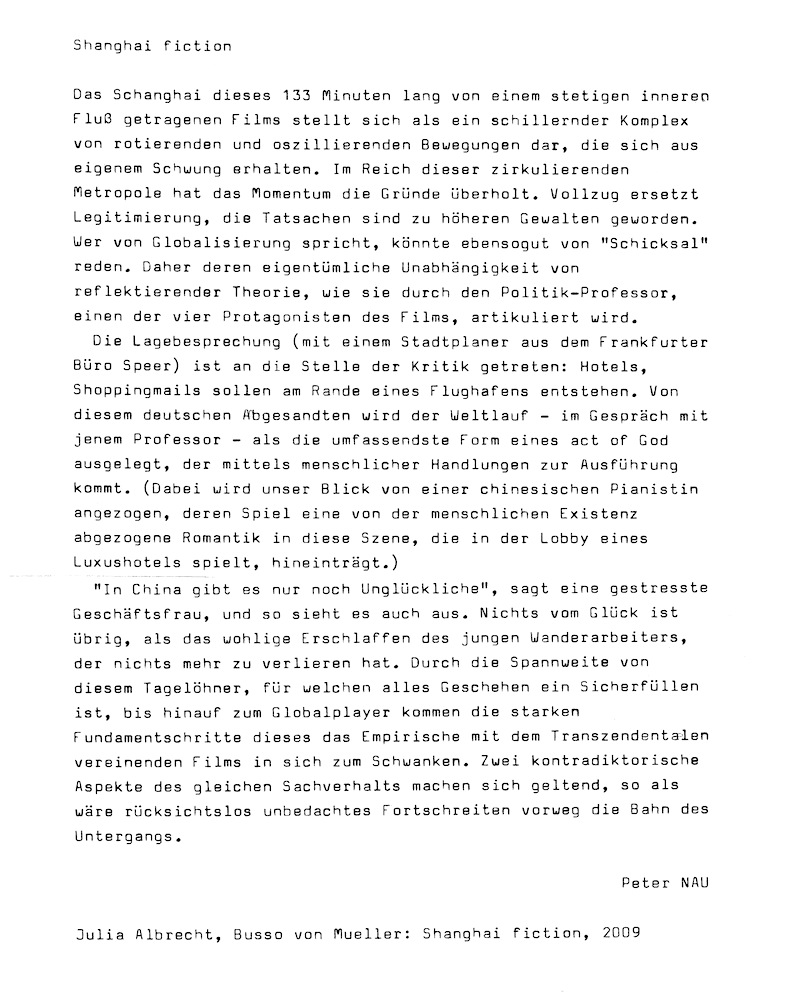„Der gehende Mann“ von Aurelia Georges – Anmerkungen und Notizen
Von Manfred Bauschulte


Im Museum von Volterra in der Toskana waren wir vor zwei Jahren von einer etruskischen Bronzestatuette beeindruckt. Sie trägt dort den Namen „Ombra della Sera“ (Abendschatten). Im Geist des Fin de siècle hat ihr der italienische Schriftsteller Gabriele D’Annunzio diesen Namen angedichtet. Ohne Zweifel geschah dies in verklärender Absicht. Die Bronze aus dem 2. vorchristlichen Jahrhundert zeigt dagegen eine Spindel dürre, hoch aufgerichtete Gestalt mit ganz langen, eng anliegenden Armen und einem winzigen aufgesetzten und lächelnden Kindergesicht. Der Faszination der äußerst filigranen Figur, die ursprünglich als Grabbeigabe diente, kann man sich unmöglich entziehen. Denn es scheint geradezu, als habe sie eine berühmte Skulptur von Alberto Giacometti, den „L’homme qui marche“, vorweggenommen.
Im direkten Vergleich mit der Skulptur von Giacometti ist man versucht zu sagen, der Bildhauer habe 2000 Jahre später (1961) die etruskische Figur buchstäblich in Bewegung versetzt. Das Statuarische der Bronzegestalt, die erhaben und vollkommen in sich ruht, übersetzt der moderne Künstler in Unruhe. Er versetzt die Ruhe in eine extreme Hast und Rastlosigkeit, die jetzt voller Fragezeichen stecken. „Der gehende Mann“ ist von nun an für immer unterwegs, gehetzt und auf der Flucht. Sein gebeugter Gang lässt Betrachter fragen: Was lastet auf ihm? Was treibt ihn? Wohin will er? Ist er ein ewiger Wanderer? – Dagegen wirkt die etruskische Statuette beseelt, wenn nicht beseligt von Gewissheit. Die Beseligung rührt daher, dass sie in der Gewissheit des Todes steht. Sie gemahnt an eine bis zur Naivität, bis zur Kindlichkeit erstarrte Totenruhe. Vermutlich handelt sich es um eine Grabbeigabe für ein verstorbenes Kind, einen Jungen, worauf das kleine Glied verweist.
In Verbindung mit der 2000 Jahre alten Bronzefigur des Kindes in Volterra stellt sich natürlich die Frage: Ist es nicht ein Symptom unserer Zeit, dass ausgerechnet „Der gehende Mann“ von Giacometti im Februar dieser Jahres (2010) spektakulär unter den Hammer kam? Die Commerzbank verkaufte die Skulptur in Folge der Finanzkrise an einen privaten Sammler für die Rekordsumme von 103 Millionen Dollar. Was passierte hier mit einem modernen Artefakt? Die künstlerische Aktion, die Arbeit des Ausdrucks von Giacometti ist das Eine. Das Andere ist die finanzielle Transaktion. Sie verweist auf eine kapitalistische Schizophrenie, die nur das Höher und Weiter, das Sich-Messen und Vergleichen kennt. Diese Schizophrenie kann nichts entwickeln und zur Reife bringen, oder freudianisch gesprochen: Konkurrieren fällt zurück in eine präödipale Haltung.
Bewegung und Flucht, Ungewissheit und Unruhe des gehenden Mannes begegneten mir nun gleichzeitig auf eine andere Weise in dem gleichnamigen Film von Aurelia Georges wieder, einem erstaunlichen Erstlingsfilm. Dieser Film ist vor zwei/drei Jahren entstanden und wird seither immer mal wieder gezeigt. Er dokumentiert chronologisch das Leben des russischen Malers und Schriftstellers Vladimir Slepian in den Jahren zwischen 1974 und 1996. Slepian lebte zuletzt als Obdachloser im Pariser Quartier Latin. Er brach dort 1998 auf offener Straße zusammen und starb elend. Bis in die Wahl des spanischen Hauptdarstellers (César Sarachu), der den Schriftsteller Victor Atemian verkörpert und Slepians Texte liest und spricht, überträgt Aurelia Georges die Erinnerung an den russischen Künstler in Bilder und Töne. Mit einigen Anmerkungen und Notizen will ich den Eindrücken nachgehen, die dieser Film bei mir auslöst hat, und einige Schlussfolgerungen ziehen.
Vladimir Slepian, 1930 in Prag geboren, Sohn eines im Gulag umgekommenen russischen Funktionärs, wuchs in Moskau auf und wurde in den 1950er Jahren zum Maler ausgebildet. Als Konzeptkünstler schuf er eine eigene Stilrichtung, die „transfinite Malerei“, an die er in Paris nach der Emigration (1958) durch Ausstellungen in namhaften Galerien erfolgreich anknüpfen konnte. In den 1960er Jahren verlagerte er seinen Schwerpunkt hin zur Literatur. In Paris konnte er sich durch die Gründung eines gut gehenden russischen Übersetzungsbüros für gewisse Zeit eine gesicherte Existenz aufbauen.
Hier (1974) setzt der Film von Aurelia Georges ein. Der Protagonist Victor Atemian trägt in einem Pariser Milieu von Intellektuellen vor. Es handelt sich dabei um einen Text von Slepian, der zwischen Pamphlet und Prosa, Publikumsbeschimpfung und Persiflage changiert. Sein Titel lautet „Fils de chien“. Er erschien zeitgleich in der Nummer 7 der Zeitschrift „Minuit“, dem Forum für die Autoren des französischen „Nouveau roman“, und erregte Aufsehen. „Fils de chien“ beschreibt in Anlehnung an Kafkas „Verwandlung“ wie ein Mensch sich in einen Hund verwandeln will. Auf eine verstörend assoziierende Weise tritt der Autor in einen Prozess der Beschreibung von Entmenschlichung ein, die eine der Animalisierung des Menschen ist. Der Leser oder Zuhörer fragt sich: Ist das schreibende Subjekt noch ein Mensch oder schon ein Tier. Die Zweideutigkeit der Prozessbeschreibung wird durch den Tonfall des Textes evoziert. Er springt zwischen Anklage (der Unmenschlichkeit) und Klage (über die Animalisierung) hin und her. Am Ende scheitert die Verwandlung in ein Tier, weil es dem Schreibenden nicht möglich ist, sich von seiner Bewusstheit zu lösen. Er kann sich aber auch nicht restlos einem animalischen Unbewussten überlassen. Diese Unentschiedenheit führt ihn stattdessen zurück in ein frühkindliches Stadium. Explizit muss die Verwandlung misslingen, weil des dem Autor nicht möglich ist, sich vorzustellen, dass er wie ein Hund über einen Schwanz verfügen kann.
Im Film wird die literarische Ebene der Verwandlung in einen Hund nur angerissen. Hingegen wird sie auf der bildlichen Ebene durch eine sprechende Episode sehr direkt entwickelt. Im ersten Teil, in dem der Schriftsteller Atemian noch mit anderen Menschen kommuniziert, lädt er einen befreundeten Photograph zu einem Labyrinth-Spiel ein. Es besteht darin, sich von zwei Seiten, von Norden und Süden, in der Stadt Paris auf einander zu zu bewegen, sich eventuell irgendwo zu treffen oder für immer zu verfehlen. Im Spiel spürt der Photograph das geheime Ziel Atemians auf. Dort trifft er und photographiert er ihn. Es handelt sich um einen Saal im Louvre, in dem eine Staue des ägyptischen Gottes Anubis aufbewahrt wird. Anubis ist der ägyptische Name für „junger Hund“. Er galt als Totengott aber auch als Friedhofswächter und Totengeleiter. Atemian stellt sich in spielerischen Posen neben die antike Skulptur, entwickelt Formen der Mimkry und umkreist sie. Schließlich wirft er sich ihr zu Füssen. Er spielt auf groteske Weise sich selbst als Hund, während ihn der Freund die ganze Zeit photographiert. Wie es scheint, will er im Louvre wieder zum Kleinkind werden, das krabbelnd und hemmungslos Hund spielen kann. Gleichzeitig möchte er beobachtet werden, freut er sich über Zeugen für sein Spiel. Schließlich hat er den Zeugen selbst zu diesem Spiel verführt und eingeladen.
Im weiteren Verlauf weicht der Film von Aurelia Georges dem Schriftsteller Atemian nicht mehr von der Seite. Er zeigt die physischen Veränderungen, die er in der Zeit (von 1974 bis 1996) und im Raum (im Paris des Quartier Latin und der Ecole Normale Superieure) erfährt. Nach dem Verkauf seiner Wohnung, nach einem Leben im Hotel und bei Freunden verliert er Bleibe und Unterkunft, am Ende jeden Halt. Sein Verschwinden impliziert, dass er seine alte Identität ablegt und von Bekannten mit einem neuen Namen angesprochen werden will. Geschichtliche Zeitumstände (der 1980er Jahre: die Wahl Mitterands und der Fall der Mauer) wie die intellektuellen Abenteuer seiner Umgebung (der 1970er Jahre: die Seminare Lacans) bilden Kulissen für seinen Abstieg und Verfall. Seine Gänge durch die Stadt Paris und Streifzüge durch deren Peripherie werden zu Stationen der Entpersönlichung. Sie vollzieht sich schleichend – am Körper des Protagonisten. Der Film folgt ihren Spuren und will sie lesbar machen.
Wo der Film sich auf die Spuren der Entpersönlichung des Protagonisten begibt und konzentriert, registriert er beiläufig die Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit seiner Umgebung, der ihn umgebenden Menschen. Es scheint, als sei die Außenwelt nicht bereit und fähig zu erkennen, wie ein Mensch (innerlich) aus der Welt verschwindet. Atemian fällt aus der Welt, obgleich er doch physisch da ist. So gesehen kann der Film nicht anders operieren: Er muss äußere Stationen als Merkmale der Depersonalisation festhalten. Die inneren Mechanismen lassen sich nur vermuten, anhand von Textfragmenten des Schriftstellers erschließen.
Der Film von Aurelia Georges dokumentiert die äußeren Verfallserscheinungen einer modernen Künstler-Existenz, die nur fragmentarisch in Erscheinung treten konnte. Er entwickelt ein Gespür für die physischen Veränderungen, an denen sich das Schicksal des Victor Atemian (-Wladimir Slepian) ablesen lässt. Beim Betrachter werden auf Grund der fragmentarischen Äußerungen und Texte des Protagonisten deutliche Fragen nach seinen Beweggründen und seinem Innenleben wachgerufen. Die dokumentierten Außenansichten des gehenden Mannes, der sich selbst zerstört, verlangen geradezu nach Einsichten in seine Innenwelt.
Einblick könnte die folgende Perspektive gewähren, über die ich in Ansätzen spekulieren will: „Fils de chien“, der einzige Text Slepians, fand durch die Hintertür Eingang in die moderne Philosophie. Deleuze/Guattari nahmen den Text in „Mille Plateaux“ auf. Er bildete ein Grundmuster von Intensivierung und Tierwerdung für ihre Theorie vom „Anti-Ödipus“. Im Anschluss an Lesarten von Hugo von Hofmannsthals „Lord Chandos“ entwickelten sie Muster für die unnatürliche Teilhabe an der Welt, die aus jedem Grundkonzept der Psychoanalyse herausspringen. Sie entwickelten Formen, die jede ödipale Teilhabe verweigern. Slepian, der für sich den Namen Eric Pide wählte (Anagramm und Pseudonym des griechischen Namens Ödipus) bricht für Deleuze/Guattari mit seinem Text „Fils de chien“ so planvoll wie gezielt aus jeder Ödipalität aus. Absicht und Plan seiner Hundwerdung lassen sich nicht realisieren, weil sie ein unendliches Experiment (ein transfinites Unternehmen?) impliziert, in dem etwas für immer unerfüllt, nicht repräsentiert, nicht verwandelt werden kann. Wo der Wunsch immer unerfüllt bleiben muss, bleibt nur die kindliche Rückkehr zur Mutter, die unendliche Regression. Jede intendierte wie planvolle Selbstfindung fällt (Deleuze/Guattari zufolge) unter den Verdacht der Herrschaft (des Ödipus). Der Schriftsteller Eric Pide (Slepian), der einen Text wie „Fils de chien“ schreibt, wäre so der Prototyp eines modernen Anti-Ödipus. Seine plan- und ziellosen Aktionen stünden im Zeichen eines Aufstands gegen die Domestizierung des Ödipus.
Aurelia Georges verweigert Einblicke in die Innenwelten von Atemian (-Slepian). Darin liegt das Faszinosum ihres Films. Gleichwohl dokumentiert er die Fluchtbewegungen eines Intellektuellen, der den Veränderungen in der Welt nicht mehr gewachsen ist, nicht mehr an ihnen teilhaben kann und will. Daher fällt er aus ihr so gestalt- wie namenlos heraus. – Seine Selbstzerstörung wirft brennende Fragen auf. Bürgerliche Fluchtbewegungen führten in die Südsee, auf den Monte Verita oder in die Landkommune. Wohin treibt es die Fliehenden unserer Tage? Fliehen sie in ein ort- und zeitloses Labyrinth? Oder: Wie ist es möglich Widerstände in den Bewegungen der Selbstzerstörung auszubilden? – Genau zu solchen Fragen stiftet der Film von Aurelia Georges an.