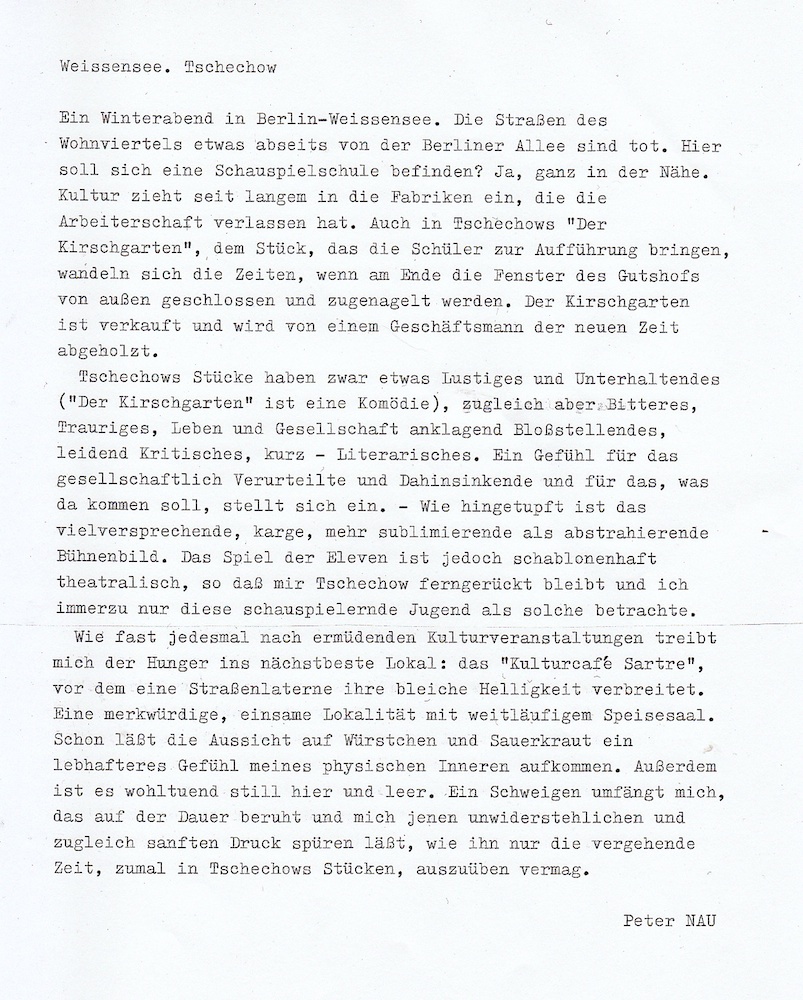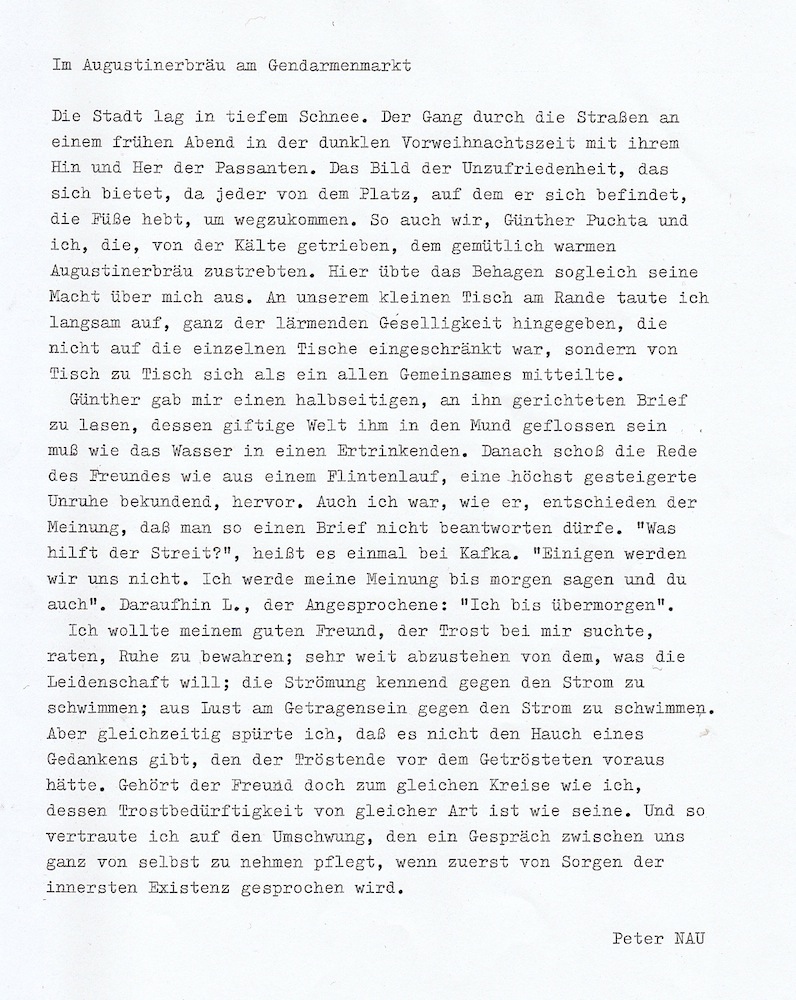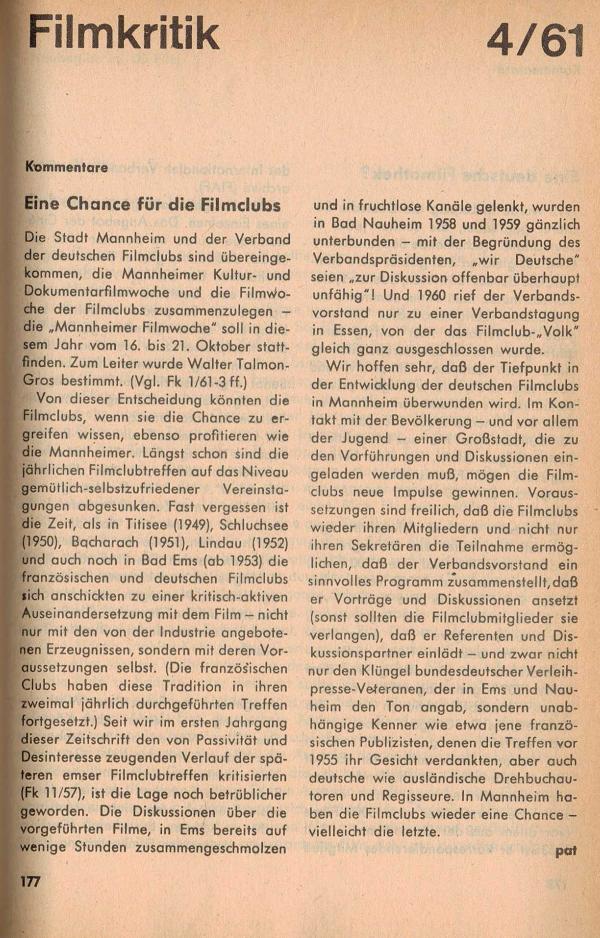Samstag, 09.03.2013
Mittwoch, 06.03.2013
Filme der Fünfziger VII: Das letzte Rezept
„Das letzte Rezept“ kann Endgültiges bedeuten, auch Tragisch – Dramatisches, vielleicht den Tod, auf jeden Fall Unumkehrbares. Im gleichnamigen Film von Rolf Hansen aus dem Jahr 1952 gibt es diese Konnotationen bis hin zur Banalität – eben des letzten Rezeptes, das ein Arzt ausschreibt. Das Rezept kuriert keine Krankheit; es bildet und tilgt Schuld, führt zerstrittene Parteien an den Festtagstisch, macht die kranke Gesellschaft wieder gesund und löst die Atemnot der Bedrückten – „Macht das Fenster auf, es ist so stickig hier“ ruft Carl Wery, der alte Arztvater, der nicht weichen wollte und sich jetzt mit der nachfolgenden Generation versöhnt. Wie Unschuldige schuldig werden und von dieser Schuld erlöst werden durch eine Frau, die sich stärkt mit Gebet und Kunst, mit „Vater Unser“ und Hugo von Hofmannsthal – das alles erzählt Hansen in einem seiner ersten Melodramen der fünfziger Jahre. Der Aufwand an Glaubenskraft und Kunstverehrung, an strahlendem Licht und finsteren Dämonen ist beträchtlich; im Jahr 1952 muß ja auch noch eine große Verdrängungs- und Bewältigungsleistung erbracht werden. Die Schlusssentenz der Gottesstimme verkündet dem deutschen Publikum sieben Jahre nach dem Zusammenbruch: „Eine schwere Zeit ist wie ein dunkles Tor/ gehst Du hindurch, trittst Du gestärkt davor. /Stehst neu vor Gottes Angesicht, wendt‘ sich alles/ vom Dunkel zum Licht.“
Die süchtige Primaballerina Bozena Boroszi (Sybil Verden) will sich zur „Jedermann“-Saison in Salzburg Morphium verschaffen, aber ihr Dealer (Harald Paulsen) wird verhaftet. Sie umgarnt den Apotheker Hans Falkner (O.W. Fischer) und stiehlt aus seinem Safe Morphium-Ampullen. Der ernst gestimmte Dr. Steininger (Rene Deltgen) hält seinen Studienfreund Falkner für einen Hallodri und verdächtigt ihn, der Primaballerina das Rauschgíft verschafft zu haben. Steininger ist immer noch in Anna (Heidemarie Hatheyer) verliebt, die aber Hans geheiratet hat. Der alte Sanitätsrat Falkner (Carl Wery) kreidet seinem Sohn Hans an, dass er nicht Arzt, sondern Apotheker geworden ist. Daran ist Anna Schuld. Die Primaballerina erpresst das Apothekerpaar – nur wenn sie ihr weiter Morphium besorgen, wird sie das Paar nicht bei der Polizei anzeigen. Steininger drängt den alten Arzt, endlich seinen Beruf aufzugeben – in seinem hohen Alter könne man schon mal mit einer Fehldiagnose großes Unglück anrichten. Diese vielen Geschichten kulminieren: Die Primaballerina wird ohnmächtig, der alte Sanitätsrat verschreibt ihr irrtümlich eine tödliche Dosis Strychnin und die Apothekerin Anna Falkner muss nun entscheiden, ob sie die richtige oder die tödliche Dosis anmischt.
Rolf Hansen ist ein Frauenregisseur; in den 40er Jahren inszenierte er Zarah Leander, jetzt spielt Heidemarie Hatheyer Erlöserin, Mutter eines kleines Sohnes, Ehefrau eines bübischen Ehemanns, und schließlich die große, alles entscheidende Figur. Sie geht durch hohe, enge Gassen, wird in Licht und Dunkel getaucht, wendet die Augen in Großaufnahme zum Himmel und steht im Fensterrahmen als Ikone der Reinheit. Die Räume der Apotheke und des Wohnhauses sind zwar eng und bedrückend, aber die Außenwelt ist noch viel bedrohlicher. Durch die Straßen von Salzburg und in die Handlung hinein klingen die Stimmen der „Jedermann“ Aufführung.
Wie unreif die Männer sind und wie sehr sie es geniessen! Nur die Frauen haben die Macht, Konflikte zu verschärfen oder zu entschärfen. Falkner verteidigt gegenüber seinem Vater die Entscheidung, statt Arzt Apotheker geworden zu sein, damit, dass seine Frau die Apotheke geerbt habe. Er eilt zur Ballerina und erklärt ihr, dass seine Frau sich wundere, wie das Morphium aus dem Safe verschwinden konnte. Als Anna Falkner ihren ehemaligen Geliebten Dr. Steininger um Hilfe bittet, vermutet der, dass Anna von ihrem Mann geschickt wurde. Anna ist empört: „Das ist so geschmacklos, so grenzenlos gemein.“ Damit könnte sie auch das Verhalten ihres Mannes charakterisieren.
Hansen und sein Kameramann Weihmayr inszenieren mit Fahrten, Kadrierungen, unaufdringlichen Unter- und Aufsichten Enge, Überlastung, Abhängigkeiten und Befindlichkeiten. Rene Deltgens Gesicht ist gelegentlich wir dämonisch ausgeleuchtet, Verden ermattet auf Kissen gelegt und Hatheyer ins sanfte Licht einer irdischen Schmerzens-Madonna getaucht.
Sechs Filme mit O.W. Fischer wurden 1952 in der Bundesrepublik uraufgeführt. Mit Charme, Frechheit und Künstlertolle bezauberte er die Fräulein und Damen gleichermaßen. Die Last der Vergangenheit hat in seinem Spiel keinen Platz; er ist der Vertreter der heiteren Lebenslust, mit flatterndem Apothekerkittel, fesch gebundenem Schal und etwas manierierter Zigarettenspitze ausgestattet. Binnen eines Jahres wurde Fischer nach Dieter Borsche zum Publikumsliebling Nr. 2.
Der Film lief als deutscher Beitrag beim Filmfestival Cannes 1952. Sybil Verden war die Titelgeschichte des „Spiegel“ Nr.23 vom 4.6.1952. In den USA lief „Das letzte Rezept“ unter dem Titel „Desires“; „Desires is the first German film in several years that is worth the expense of its subtitles.“ Time (2. 8. 1954)
Was nicht in „Filmportal“ und auch nicht in IMDB steht:
Liesl Karstadt spielt Frau Berger, die Haushaltshilfe von Sanitätsrat Dr. Falkner (das ist sogar in der Illustrierten Film-Bühne falsch). Heini Göbel spielt den verdächtigen Herrn aus einem Cafe, Franz Muxeneder einen der Detektive, Bum Krüger einen Kompagnon des Rauschgifthändlers, Bobby Todd den Theaterinspizienten. Heinz Hölscher und Richard Weihmayr waren Kamerassistenten, Oskar Schlippe Regieassistent.
Nicht als Video, nicht als DVD erhältlich.
Samstag, 02.03.2013
Freitag, 01.03.2013
Kinohinweis (Berlin)
* Filmreihe Ein Lied um Mitternacht – Chinesische Filmgeschichte von 1929 bis 1964 vom 1. bis 31. März im Arsenal
Mittwoch, 27.02.2013
Beim jüngsten Gericht/ Erschienen sie nicht
Richard v. Schirach, Die Nacht der Physiker. Heisenberg, Hahn, Weizsäcker und die deutsche Bombe, 2012, Berenberg Verlag,
Hier geht es nicht nur um die nicht gebaute „deutsche Bombe“, sondern auch um die Bombe, die die Amerikaner bauten und warfen und sich damit als erste schuldig machten. Deshalb stimmt das Buch sehr, sehr nachdenklich. Die Erleichterung, dass nicht Nazi-Deutschland den Wettlauf gewann, wird vom Horror von Hiroshima und Nagasaki, den das Buch noch einmal vergegenwärtigt, verdrängt. Die verantwortlichen amerikanischen Wissenschaftler wie Robert Oppenheimer kamen nicht mehr zur Ruhe: „Wir wussten, dass die Welt nicht mehr dieselbe sein würde…Ich erinnerte mich der Zeilen aus der Hindu-Schrift, der Bhagavadgita: ’Jetzt bin ich zum Tod geworden, zum Zerstörer der Welten.’ Ich nehme an, dass wir alle in der einen oder anderen Weise so dachten.“ Eisenhower, der Oberkommandierende der alliierten Truppen begründete damals seine Ablehnung des Bombenabwurfs so: „Einmal waren die Japaner bereit zu kapitulieren, und es war nicht notwendig, sie mit dieser furchtbaren Waffe zu schlagen. Zum andern war mir der Gedanke verhasst, dass unser Land als Erstes eine solche Waffe einsetzen sollte.“
Schirachs Buch zeigt nachvollziehbar, wie bei den 1945 von den Alliierten internierten deutschen Physikern (u. a. Otto Hahn, Werner Heisenberg und Carl Friedrich von Weizsäcker) ein Umdenken einsetzt, aber wie verhältnismäßig komfortabel es doch für sie ist, dass sie keine Chance hatten, direkt schuldig zu werden, weil ihre Forschung noch weit zurück lag. Die Abhörprotokolle aus dem englischen Landsitz Farm Hall zeigen die Entwicklungen in den Monaten der Isolation. Ich wünschte mir beim Lesen, dass jemand daraus eine schöne Fernsehserie machen würde, mit all den tragischen und komischen Bestandteilen, die den Beteiligten selbst klar waren und mit Elementen des alten Bildungsfernsehens, wo die Geheimnisse des Atoms sich mir dann auch erschließen würden.
Carl Friedrich von Weizsäcker, der sich dort die Zeit mit dem Dichten von Sonetten und Limericks vertrieb, trägt seinen Kollegen kurz vor der Entlassung aus der Gefangenschaft diese erstaunlichen Verse vor – von der Erleichterung wohl zur frivolen Verdrehung ermutigt:
„Es waren zehn Forscher in Farm Hall,
Die galten als fürchterlich harmvoll.
Beim jüngsten Gericht
Erschienen sie nicht,
Denn sie saßen noch immer in Farm Hall.“
Montag, 25.02.2013
Donnerstag, 14.02.2013
Eine Einstellung zur Arbeit
* Antje Ehmann & Harun Farocki, Eine Einstellung zur Arbeit | Labour in a Single Shot
Planetary Projection
* Planetary Projection. An Oral History of Film Projection.
how to write
»Sechstens also die große Frage, weshalb einer überhaupt eine Bahn einschlagen muss. […] Hat einer schon deshalb versagt, weil er die Bescheidenheit nicht aufbringen kann, sein Leben lang stur dasselbe zu tun?«
[Stefan Ripplinger: Schiefe Bahn. Künstler, die schreiben, Berlin: Wiens Verlag 2013; Heft 1 der schönen Reihe how to write, in der zeitgleich Hefte von Jimmie Durham, Dieter Roth, Hague Yang und Tomas Schmit erschienen sind]
Montag, 04.02.2013
Le Bachfilm

© Sammlung Heiner Roß / Nachlaß Joachim Wolf (Kinemathek Hamburg) im Filmmuseum München
Reichhaltiges Material ist erschienen zur Chronik der Anna Magdalena Bach und zu Jean-Marie Straubs achtzigstem Geburtstag: 2 DVDs, ein Begleitbuch von 154 Seiten, viele bislang unbekannte Fotographien und Dokumente. (Subskriptionsangebot bei éditionsmontparnasse)
Danièle Huillet und Jean-Marie Straub sind, wie Benoît Turquety in seinem Aufsatz „Jeunesses musicales. L’invention de Chronik der Anna Magdalena Bach“ ausführt, durch die Musik zum Film gekommen: die Chronik war ihr erstes Projekt, zu datieren auf den November 1954. Schönbergs Moses und Aron, ihr zweites Projekt, geht auf die Jahre 1958/59 zurück. Die Chronik, schreibt Turquety, war entscheidend für alles, was danach gefolgt ist: „Die Idee war, mit einem musikalischen Text so zu verfahren, wie Bresson es mit einem literarischen Text – dem Tagebuch eines Landpfarrers (1951) – von Bernanos gemacht hatte. Musik sollte darin als Materie wahrgenommen und als solche respektiert werden, keine ‚Filmmusik’ sein, sondern das Angebot eines besonderen Hörens durch die Kinematographie.“ Eine Tat war es dann, den noch unbekannten Musiker und Dirigenten Gustav Leonhardt zu entdecken und dreizehn Jahre später mit ihm, Nikolaus Harnoncourt, Christiane Lang-Drewanz und vielen andern den Film zu realisieren. Die frühe Wahl erfolgte, Turquety hebt das hervor, ausschliesslich über das Hören einer Platte Leonhardts: „Der ist es!“ Wie dieses Medium (und das Medium Film) die Musik erneut hören lässt (im einmaligen historischen Zugriff), so sei es darum gegangen, Bach neu und so zu hören, wie er seit langem nicht mehr gehört worden sei. Es habe sich nicht darum gehandelt, „Bach auf historischen Instrumenten so zu interpretieren, als sei seither nichts passiert, sondern diese Interpretation gegen das zu stellen, was seither gemacht worden sei.“ (Er nennt die Namen Karajan oder Gould.) In dem der Chronik vorangestellten Péguy-Zitat sieht Turquety einen Ausfluss dessen, was da musikalisch vor sich geht und sich dann politisch auflädt: „Faire la révolution c’est aussi remettre en place des choses très anciennes mais oubliées.“
Die Chronik der Anna Magdalena Bach (BRD 1967; Uraufführung 3.2.1968 in Utrecht) gibt es in der deutschen Originalversion mit Untertiteln in vier verschiedenen Sprachen: aber so ziemlich vergessen war, dass Huillet & Straub damals den Off-Kommentar auch französisch aufgenommen und nur die Dialoge untertitelt haben. „Dann sind wir auf den Geschmack gekommen“, sagt Straub, „und haben die niederländische, die englische und die italienische Version des Kommentars erarbeitet.“ Die Chronik – Chronique – Cronicle – Cronaca – Kroniek der Anna Magdalena Bach gibt es also nun in fünf Sprachversionen auf DVD 1, auf DVD 2 eine Filmdokumentation von Henk de By (Signalement de Jean-Marie Straub, 1968, 41 Minuten; einer der drei Kameraleute war Johan van der Keuken), ein Gespräch mit der ‚Anna Magdalena’ des Films, Christiane Lang-Drewanz (2012, 30 Minuten), Erinnerungen von Nikolaus Harnoncourt an die Dreharbeiten (2012, 21 Minuten), Gilles Deleuzes „Qu’est-ce que l’acte de création?“ (Vortrag bei der Femis vom 17. März 1987, 8 Minuten) plus unbekannte Fotographien und Dokumente.
Unbedingt erwähnenswert noch das ausführliche Gespräch (passagenweise übersetzt von Bernard Eisenschitz), das Helmut Färber mit Jean-Marie Straub über die Chronik an drei Tagen im Mai 2010 geführt hat: es geht hier wirklich, Rolle auf Rolle, um Einstellungen und Zusammenhänge, die sich nur aus diesem Blick aufs Detail ergeben. (Färber stützt sich dabei auf das Cinemathek-Bändchen 23 von 1969 über die Chronik, das ja von ihm damals im Verlag Filmkritik redaktionell betreut worden ist).
Dies alles, ebenso wie ein einführender Text von Barbara Ulrich und eine „découpage intégral du film“, also im Begleitband der Kassette.